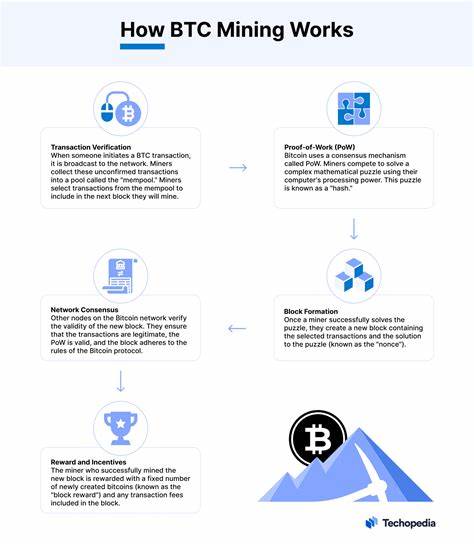Im August 2014 wurde der United States Digital Service (USDS) ins Leben gerufen. Ziel war es, technologische Expertise und moderne Softwareentwicklung in den US-Bundesdienst zu integrieren, um digitale Dienste für die Öffentlichkeit zu verbessern. Elf Jahre später wurde eine weitreichende Umstrukturierung beschlossen: Im Januar 2025 unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Executive Order, die USDS in das Department of Government Efficiency (abgekürzt DOGE) umbenannte und organisatorisch neu aufstellte. Diese Veränderung sollte den Modernisierungsprozess weiter beschleunigen und die Effizienz auf Bundesebene signifikant steigern. Mit dieser neuen Initiative wurde ein klarer Fokus auf Kostensenkung und Optimierung von Verwaltungsprozessen gelegt, die bisher durch veraltete Verfahren geprägt waren.
Ein zentraler Teil der neuen Executive Order war die Verpflichtung jeder Bundesbehörde, innerhalb von 30 Tagen sogenannte DOGE-Teams zu bilden. Diese Teams bestehen aus mindestens vier Mitarbeitern, darunter ein Teamleiter, ein Softwareingenieur, ein Personalverantwortlicher und ein Rechtsanwalt. Die Aufgabe dieser Teams ist es, die Zusammenarbeit mit DOGE zu koordinieren und die Umsetzung der Effizienzagenda des Präsidenten innerhalb der jeweiligen Behörden sicherzustellen. Ziel ist es, schnellere, transparentere und wirksamere Verwaltungsprozesse zu schaffen, die letztlich den Bürgerinnen und Bürgern Nutzen bringen. Der persönliche Bericht eines Senior Advisors und Softwareingenieurs, der im März 2025 zur DOGE-Abteilung des Department of Veterans Affairs (VA) kam, veranschaulicht die Realität und die Herausforderungen hinter den offiziellen Initiativen.
Die Behörde, die jährlich über 350 Milliarden US-Dollar verwaltet und mit rund 473.000 Beschäftigten eine der größten federal Institutionen darstellt, stand vor großen Modernisierungsproblemen. Eine der Hauptaufgaben war die Überprüfung von über 90.000 laufenden Verträgen des VA, die bislang manuell und ineffizient bewältigt wurden. Der Mitarbeiter schlug vor, maschinelles Lernen und Large Language Models (LLMs) zu nutzen, um Verträge zu analysieren und ineffiziente oder überflüssige Ausgaben besser identifizieren zu können.
Die Idee, eine automatisierte Lösung zu entwickeln, die Vertragsdaten durchforstet, kritische Dokumente hervorhebt und diese in übersichtlichen Dateien zusammenfasst, zeigte den technologischen Vorsprung und den innovativen Geist, der in das System eingebracht werden sollte. Trotz der innovativen Ansätze zeigten sich jedoch auch Einschränkungen, die den Wandel erschwerten. So waren etwa die technologischen Werkzeuge, die von Regierungsmitarbeitern genutzt werden durften, stark eingeschränkt. Sicherheitsrichtlinien verhinderten die Nutzung von populären Entwicklungsumgebungen und Tools. Dies führte zu Frustration unter den Technikern und legte offen, wie stark die Infrastruktur des öffentlichen Dienstes von externen Vertragspartnern abhängig blieb.
Die Praxis, wesentliche IT- Dienstleistungen an Großkonzerne wie IBM oder Accenture auszulagern, hat trotz der Modernisierungsoffensive Bestand, da viele Sicherheits- und Verwaltungshürden eine vollständige Inhousisierung erschweren. Ein weiterer bewegender Aspekt war die personale Umstrukturierung im VA, die durch die Umsetzung einer Reduzierung des Personals realisiert wurde. Die sogenannten Reduction in Force (RIF) Regeln, die aus historischen Veteranengesetzen stammen, legten fest, dass Kündigungen vor allem nach der Dauer der Beschäftigung entschieden werden, mit Veteranen-Privilegien und Leistungskriterien als sekundäre Faktoren. Dies unterscheidet sich deutlich von privatwirtschaftlichen Praktiken, wo meistens Leistung und Funktion im Vordergrund stehen. Die genaue Umsetzung dieser Regelungen stieß intern auf Widerstand, da sie junge Talente und qualifizierte neu Eingestellte zuerst trafen, während ältere, teilweise weniger leistungsstarke Mitarbeiter länger im Dienst blieben.
Inmitten dieser organisatorischen und technischen Probleme gab es dennoch bemerkenswerte Fortschritte. So wurden bereits bestehende offene Softwareprojekte identifiziert, darunter das elektronische Gesundheitssystem VistA, das seit über 40 Jahren vom VA entwickelt wird. Die Integration moderner Technologien bei gleichzeitiger Öffnung der Codebasis sollte dazu führen, dass Innovationen schneller vorankommen und mehr Fachkräfte an Lösungen mitwirken können. Zudem wurde die Optimierung von HR-Systemen erreicht, indem verschiedene Datenquellen konsolidiert und visualisiert wurden – eine technische Grundlage, die bei der Umsetzung der RIF-Pläne half. Ein konkretes Beispiel für digitale Innovation innerhalb von DOGE war die Aktualisierung einer internen Version eines Chatbots ähnlich ChatGPT – "VAGPT" genannt –, der für die Betreuung von Veteranen entwickelt wurde.
Dieser wurde optisch modernisiert, mobil freundlich gestaltet und soll künftig die Kommunikation sowie den Zugriff auf Angebote erleichtern. Die Initiative, den Quellcode öffentlich zugänglich zu machen, unterstreicht die Bemühungen um Transparenz und die Förderung offener Zusammenarbeit sowohl innerhalb des öffentlichen Sektors als auch mit der Zivilgesellschaft. Trotz des Potenzials wurde der Mitarbeiter nach knapp zwei Monaten abrupt aus seinem Dienst entlassen, was die oft volatile und politisch aufgeladene Natur der Regierungsarbeit illustriert. Die Gründe dafür blieben unklar, doch es sorgte für Diskussionen über die schwierigen Bedingungen, unter denen innovative Fachkräfte im Staatsdienst agieren müssen. Zeitgleich zur Entlassung gingen Berichte über Massenentlassungen bei VA-Mitarbeitern durch die Medien, was die öffentliche Wahrnehmung des DOGE-Programms stark beeinflusste.
Dabei zeigte sich, dass DOGE kaum direkte Entscheidungsbefugnis hatte; Verantwortlich für solche Maßnahmen waren vielmehr die jeweiligen Behördenleiter. Insgesamt offenbart die Geschichte des Department of Government Efficiency eine komplizierte Mischung aus Ambitionen, bürokratischen Zwängen und Fortschritt. Die Einführung von Künstlicher Intelligenz zur Effizienzsteigerung, der Aufbau spezialisierter Teams für Prozessoptimierung und die gewollte Öffnung von Softwareprojekten markieren bedeutende Schritte auf dem Weg zu einem moderneren, agilen öffentlichen Dienst. Gleichzeitig zeigen die bestehenden Hürden in technischer Infrastruktur, politischen Strukturen und Personalmanagement, wie schwierig eine solche Transformation in einem komplexen Staatsapparat ist. Für die Zukunft bleibt die Hoffnung, dass die Erfahrungen und Projekte der DOGE-Teams Impulse setzen, die langfristig zu einer nachhaltigeren und bürgerfreundlicheren Verwaltung führen.
Die Balance zwischen Innovation, Sicherheit und sozialer Verantwortung wird dabei maßgeblich über den Erfolg entscheiden. Indem mehr Technologiekompetenz im öffentlichen Dienst angesiedelt wird und interne Wissensressourcen besser genutzt werden, könnten die USA in den kommenden Jahren beispielhafte Modelle für digitale Regierungsführung entwickeln, die weltweit Beachtung finden. Die Geschichte der "Doge Days" ist somit nicht nur ein Einblick in die konkreten Abläufe an einer der größten Bundesbehörden Amerikas, sondern auch ein Spiegelbild der Herausforderungen einer digitalen Revolution im Staatsdienst. Für Politik, Verwaltung und Gesellschaft gilt es gleichermaßen, diese Prozesse mitzugestalten, um die Potenziale moderner Technologien optimal zu nutzen und gleichzeitig die Interessen der vielfältigen Nutzergruppen im öffentlichen Sektor zu schützen und zu fördern.