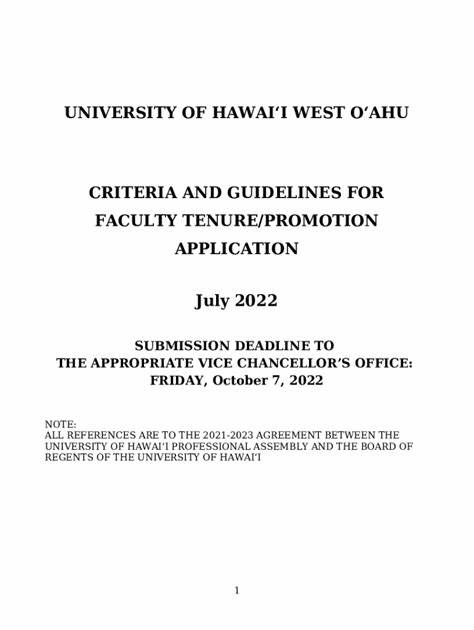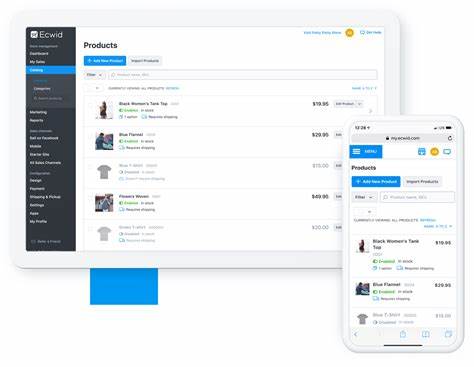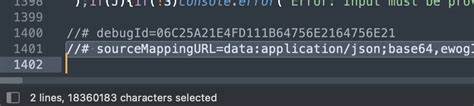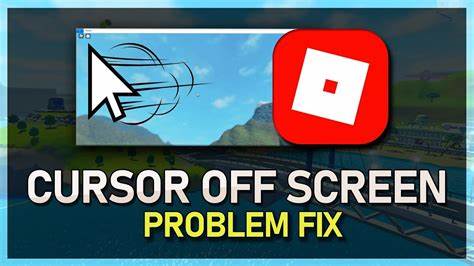An Universitäten weltweit ist die Vergabe von Tenure, also die dauerhafte Anstellung eines Professors oder einer Professorin, ein bedeutender Schritt im akademischen Karriereweg. Sie markiert nicht nur die Anerkennung wissenschaftlicher Exzellenz, sondern auch eine feste Verankerung in der universitären Gemeinschaft. Traditionsgemäß beruhte die Entscheidung über Beförderung und Tenure oft auf subjektiven Einschätzungen – sogenannten „Vibes“ –, die von der Menge der Veröffentlichungen bis hin zum persönlichen Verhalten im Fachbereich reichten. Doch unsere Universität hat angesichts moderner Anforderungen und unumgänglicher Rechtssicherheit jüngst einen formalisierten Kriterienkatalog eingeführt, der diese Prozesse transparenter, wenn auch mit einem Augenzwinkern, gestaltet. Diese Neuerungen bieten spannende Einblicke in eine akademische Welt, die sich selbst nicht allzu ernst nimmt, dabei aber grundlegende Wahrheiten anspricht, die in der täglichen Praxis allgegenwärtig sind.
Die Oberflächenbeschreibung zeigt einen humorvollen Blick auf den universitären Alltag, liefert aber auch eine Basis für die Debatte über die Sinnhaftigkeit und Herausforderungen moderner Tenure-Verfahren. Im Zentrum stehen die drei klassischen Bereiche Forschung, Lehre und universitäre Dienstleistung, die im Folgenden eingehend erläutert werden. Forschung gilt als das Herzstück der akademischen Laufbahn und als wichtigster Faktor für die Vergabe von Tenure. Die neuen Kriterien verlangen eine beeindruckende Anzahl von Publikationen in Journals, die insbesondere durch ihre Paywalls auffallen und finanzielle Hürden schaffen. Die Kennzahl der erforderlichen Veröffentlichungen wurde von einst bescheidenen Vorgaben auf fast unerreichbare Höhen geschraubt, mit dem augenzwinkernden Verweis auf die finanzielle Belastung für Leserinnen und Leser.
Darüber hinaus ist nicht nur Quantität entscheidend, sondern auch die Exzentrik und Kreativität der Forschungsagenda: Entdeckungen von astronomischen Objekten wie Quasaren und Nebeln werden ebenso verlangt wie bizarre und unrealistische Anforderungen – darunter die Entdeckung von unterseeischen Gebirgen und historischen Liebesbriefen. Diese ungewöhnlichen Forderungen spiegeln auf ironische Weise den Druck wider, innovative und eindrucksvolle Ergebnisse vorzuweisen, um innerhalb der scientific community Beachtung zu finden. Neben Publikationen sollen Forschende auch ihre öffentliche und mediale Präsenz pflegen, indem sie durch clickbaitähnliche Überschriften Aufmerksamkeit erzeugen und akademische Mythen oder kontroverse historische Behauptungen vertreten, die Diskussionen anregen – selbst wenn diese beim genauen Hinsehen absurd erscheinen. Mit persönlichem Humor wird zudem auf die interne Dynamik verwiesen, etwa in Form von Auseinandersetzungen mit Universitätsverwaltungen oder Deans. Im Bereich der Lehre, der zweiten tragenden Säule des Tenure-Prozesses, findet sich eine ähnliche Mischung aus Ernst und Satire.
Obwohl effektiver Unterricht essentiell für die universitäre Mission ist, scheint die Bewertung der Lehrqualität häufig unklar und subjektiv zu sein – weshalb die neuen Vorgaben in einem halb scherzhaften Tonfall die Schwierigkeiten dieser Messung thematisieren. Neben den üblichen studentischen Feedbackmechanismen wird erwartet, dass Lehrende trotz negativer Bewertungen psychisch belastbar bleiben. Außerdem sollen sie durch innovative oder nostalgische Anknüpfungspunkte zur Popkultur aus ihrer eigenen Jugend die Beziehung zu Studierenden stärken, wodurch auch sogenannte „verschwindende kulturelle Touchstones“ vermittelt werden. Noch weitergehend wird die Wirkung der Lehre auf die Zukunft der Studierenden hervorgehoben: Inspiration zum Graduiertenstudium, beeindruckende Vortragsabgänge mit einem „Mic Drop“-Moment und eine Lehrpersönlichkeit, die prominent verfilmt wird, sind Teil der Zielvorgaben. Diese starken bildlichen Beschreibungen werfen humorvoll Fragen zur Messbarkeit und Objektivierung von Lehrqualität und deren nachhaltiger Wirkung auf.
Der dritte zentrale Bereich ist die universitäre Dienstleistung, oft als „Service“ bezeichnet. Trotz seiner elementaren Bedeutung für den Zusammenhalt einer Hochschule wird dieser Aspekt in der Praxis häufig vernachlässigt oder nur beiläufig erwähnt. Die neuen Kriterien illustrieren diesen Umstand auf überspitzte Art, etwa durch beispielhafte Tätigkeiten wie das Übernehmen von sinnlosen Verwaltungsaufgaben, das Beraten schwieriger Studentengruppen oder das Verkleiden als Universitätsmaskottchen. Diese humorvollen Beispiele spiegeln eine Realität wider, in der Service-Aufgaben oft unbemerkt und wenig gewürdigt bleiben, zugleich aber unverzichtbar sind. Neben dem alltäglichen Dienst an der Fakultät und der Gesellschaft kommt auch äußeren Situationen, wie etwa dem Schutz von Studierenden bei Übergriffen, eine Rolle zu.
Insgesamt zeichnet das neue Regelwerk ein Bild von hohen Anforderungen, deren Erfüllung fast unmöglich erscheint – und doch nach wie vor als Grundlage für eine faire und nachvollziehbare Tenure-Entscheidung dienen soll. Die formalisierten Standards sollen Einheitlichkeit und Rechtssicherheit schaffen, werden aber durch die ironische Überspitzung auch hinterfragt. Die Verfasser der Regeln reflektieren damit nicht nur die veränderten Ansprüche in der Wissenschaft, sondern auch die Diskrepanz zwischen traditionellen akademischen Erwartungen und den Herausforderungen des modernen Hochschulbetriebs. Das zeigt sich auch in der widersprüchlichen Kommunikation innerhalb der Universität, die Tenure-Bewerberinnen und -Bewerbern oft irritierende oder gar widersprüchliche Auskünfte über ihre Chancen geben. Für die Betroffenen bedeutet das eine hohe Belastung und verlangt weit mehr als nur akademische Exzellenz: Resilienz, Kreativität und eine gewisse Portion Gelassenheit gegenüber bürokratischen Hürden werden ebenso wichtig wie die eigentliche Forschung und Lehre.
Die Einführung dieser neuen Kriterien kann als symptomatisch für die aktuelle Entwicklung an Hochschulen verstanden werden: Ein immer stärkerer Druck zur Quantifizierung von Leistungen, verbunden mit der Notwendigkeit, vielfältige Aufgaben innerhalb oft begrenzter Ressourcen zu erfüllen. Gleichzeitig wächst die Aufmerksamkeit für die Bedeutung einer transparenten und gerechten Bewertung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die motivierend und nachvollziehbar sein sollte. Der vorgestellte Kriterienkatalog zeigt, dass trotz aller Ernsthaftigkeit auch Raum für eine kritische Selbstdistanz und Humor sein muss, um den geistigen Freiraum und die kreative Atmosphäre im akademischen Betrieb zu bewahren. Zugleich unterstreicht er die Notwendigkeit, die Erwartungen an Forschende, Lehrende und Dienstleister an der Universität klar und verbindlich zu formulieren, um den vielfältigen Herausforderungen gerecht zu werden. Für angehende Professorinnen und Professoren sowie für Angehörige der Hochschulverwaltung bietet die Analyse der neuen Kriterien wertvolle Anregungen und Denkanstöße, wie Tenure-Entscheidungen transparent gestaltet und zugleich menschlich bleiben können.
Indem sowohl die Anforderungen als auch die Absurditäten akademischer Laufbahnen thematisiert werden, öffnet sich zudem ein Raum für Diskussionen über sinnvolle Reformen und zukünftige Entwicklungswege in der Wissenschaft. Letztlich bleibt der Weg zur Professur nicht nur ein akademisches, sondern auch ein persönliches Abenteuer, das Ausdauer, Innovation und gelegentlich auch Humor erfordert, um nachhaltig Erfolg zu haben.