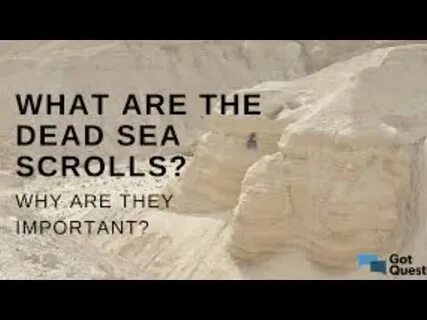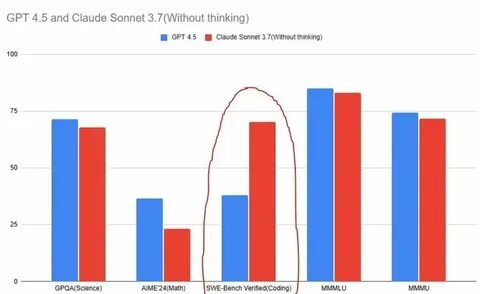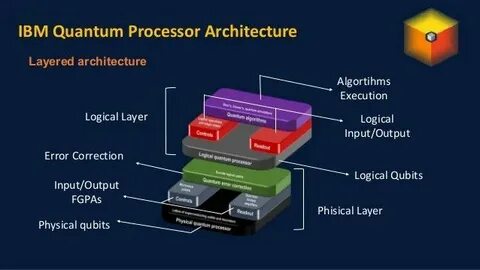In den letzten Jahrzehnten ist ein zunehmend alarmierendes Phänomen in vielen Küstenstädten weltweit zu beobachten: Sie versinken mit einer besorgniserregenden Geschwindigkeit. Dieses langsame, aber stetige Absinken des Bodens, auch als Landabsenkung oder Subsidenz bezeichnet, trifft insbesondere zahlreiche megastädtische Ballungsräume in Asien, Afrika, Europa und Amerika. Die Konsequenzen sind gravierend – von häufigerem und intensiverem Hochwasser über Gebäudeschäden bis hin zur Vertreibung ganzer Bevölkerungsgruppen. Gleichzeitig verschärft sich die Problematik durch den globalen Klimawandel und den daraus resultierenden steigenden Meeresspiegel, was die ohnehin prekären Zustände noch verschlimmert. Doch wie kommt es eigentlich zu dieser Entwicklung, welche Regionen sind besonders stark betroffen und welche Lösungsansätze gibt es? Eines der anschaulichen Beispiele für die dramatische Versinkung einer Stadt ist Jakarta, die bevölkerungsreichste Metropole Indonesiens.
Vor etwa 20 Jahren waren die Fenster vieler Häuser noch auf Brusthöhe, heute haben sie sich oft bis auf Kniehöhe abgesenkt. Die Bewohner, wie Erna und ihre Familie, leiden unter wiederkehrenden Überschwemmungen, die nicht nur das tägliche Leben erschweren, sondern auch große Gefahren bergen. Besonders der nördliche Teil Jakartas, der auf sumpfigem Schwemmland liegt, ist betroffen. Die Stadt versinkt teilweise bis zu vier Meter seit den 1970er Jahren, eine katastrophale Entwicklung, die großer Bevölkerungsgruppen entwurzelt hat. Die Kombination aus Landabsenkung und steigendem Meeresspiegel führt hier zu einem intensiven relativen Meeresspiegelanstieg.
Grundwasserentnahme ist einer der Hauptursachen für das Absinken der Städte. Millionen von Menschen sind in ihrem Alltag auf die Ressource angewiesen, die in vielen Regionen mangelhaft durch Leitungsnetze bereitgestellt wird. In Jakarta, Lagos, Bangkok und vielen weiteren großen Städten herrscht eine rasch wachsende Bevölkerungszahl, die den Wasserbedarf massiv ansteigen lässt. Da die öffentliche Infrastruktur oft nicht Schritt hält, bohren Haushalte und Industriebetriebe eigene Brunnen, um Grundwasser zu fördern. Das Entziehen von Wasser unter der Erdoberfläche führt dazu, dass der Boden zusammensackt, weil sich die unterirdischen Sedimentschichten verdichten.
Die Folge sind Risse in Häuserwänden, abgesunkene Straßen und dauerhafte Gefährdungen der Infrastruktur. Studien der Nanyang Technological University in Singapur zeigen, dass von 48 untersuchten Küstenstädten allein in Asien, Afrika, Europa und Amerika insgesamt fast 76 Millionen Menschen in Gebieten leben, die zwischen 2014 und 2020 durchschnittlich mindestens ein Zentimeter pro Jahr abgesunken sind. Besonders dramatisch ist die Situation in Tianjin, China, wo in einigen Bereichen der Boden um bis zu 18,7 Zentimeter pro Jahr sank. Dort mussten wegen massiver Gebäudeschäden tausende Bewohner evakuiert werden. Industrielle und infrastrukturelle Entwicklungen beschleunigen die Absenkung zusätzlich, da oft große Mengen Grundwasser gezogen oder Erdmassen verändert werden.
Doch nicht nur die anthropogenen Aktivitäten sind verantwortlich. Natürliche Prozesse wie tektonische Bewegungen, Bodenverdichtung und geologische Gegebenheiten spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Gerade in Städten, die auf Schwemmland oder Flussdeltas gebaut sind, ist die Betroffenheit besonders groß. In solchen Regionen, wie etwa Shanghai oder Ho-Chi-Minh-Stadt, ist der Landuntergrund naturgemäß weich und sensibel. Dort ist die Gefahr, dass sich der Boden bei Belastung und Wasserentzug setzt, deutlich höher.
Die Herausforderungen durch Landabsenkung und Meeresspiegelanstieg sind vielfältig. Überflutungen werden häufiger, intensiver und dauern länger an. Die Infrastruktur wird zu einem gewissen Teil zerstört und kann oftmals nur mit hohen Kosten instand gehalten oder angepasst werden. In Wohngebieten führen steigende Wasserstände und Senkungen zu feuchten Kellern, Rissen in Gebäuden, und in extremen Fällen zu unbewohnbaren Verhältnissen. Diese Probleme sind sozial auch sehr ungerecht verteilt, weil meist ärmere Bevölkerungsgruppen in besonders gefährdeten Gegenden leben, wie es bei Erna in Jakarta oder Rukkayat in Lagos der Fall ist.
Als Reaktion auf die Versinkung vieler Städte wurden verschiedene technische Gegenmaßnahmen umgesetzt. Deiche, Dämme und Küstenschutzmauern sollen die Flutwellen vom Land fernhalten. Allerdings können solche Bauwerke einen sogenannten „Schüssel-Effekt“ erzeugen, bei dem Regen- und Flusswasser angesammelt und nicht mehr ausreichend abgeleitet wird, was wiederum Überschwemmungen provoziert. Deshalb setzen einige Städte zusätzlich auf Pumpstationen, um die Stadt trockenzulegen. Solche Maßnahmen sind jedoch nur kurzfristige Lösungen, die weder die Grundursache – die Bodensenkung – noch den Meeresspiegelanstieg beseitigen.
Eine nachhaltige und bewährte Strategie wurde in Tokyo entwickelt. Dort führte das strikte Regulieren der Grundwasserentnahme seit den 1970er Jahren zu einer deutlichen Verlangsamung der Landabsenkung. Das städtische Wasserversorgungssystem wurde so optimiert, dass der Großteil des Trinkwassers aus externen Flüssen und Wäldern stammt und über ein komplexes Tank- und Rohrnetz verteilt wird. Diese Methode schont das Grundwasser und verhindert die schädliche Bodensetzung. Allerdings ist ein derartiges System mit erheblichen Bau- und Wartungskosten verbunden und kann nicht in allen Städten einfach übernommen werden.
Andere Ansätze umfassen das Konzept der „Schwammstädte“. Dabei werden Flächen durch begrünte Parkanlagen, Feuchtgebiete und poröse Bodenbeläge geschaffen, die Wasser aufnehmen und speichern können. Diese Lösung gilt als kostengünstiger und ökologisch nachhaltiger. Dennoch stoßen solche Initiativen bei bestehenden, dichten Stadtstrukturen oft an Grenzen, da die Flächen begrenzt und Renovierungen teuer sind. Ein weiterer innovativer Lösungsansatz findet sich in Shanghai, wo man das Grundwasserproblem durch Injektion von gereinigtem Wasser in die unterirdischen Bodenstrukturen adressiert.
Das soll den Boden stabilisieren und weiteres Absinken verhindern. Solche Methoden sind allerdings technisch anspruchsvoll und erfordern langfristige Überwachung. Langfristig ist die Reduktion der Grundwasserentnahme in Verbindung mit der Verbesserung der städtischen Wasserversorgung und innovativen Stadtplanungen entscheidend. Gleichzeitig erfordert die Problematik entschiedenes politisches Handeln und ein Bewusstsein für die nötigen Maßnahmen über Jahrzehnte hinweg. Einschränkungen bei der Nutzung von Brunnen und eine bessere Verwaltung der Wasserressourcen können zwar auf den ersten Blick unbeliebt sein, sind aber notwendig, um zukünftige Katastrophen abzuwenden.
Zusätzlich müssen die Gefahren des Klimawandels berücksichtigt werden. Steigende Oberflächentemperaturen führen zu stärkerem Niederschlag, mehr Extremwetterereignissen und weiter steigendem Meeresspiegel. Viele der sinkenden Städte sind dadurch doppelt gefährdet. Der Zustand vieler Küstenstädte spiegelt somit die Notwendigkeit wider, Stadtentwicklung nachhaltiger zu gestalten und den Klimaschutz zu forcieren. Schließlich zeigt das Beispiel Indonesiens, das einen Umzug der Hauptstadt von Jakarta auf die Insel Borneo plant, wie drastisch die Folgen der Versinkung sein können.