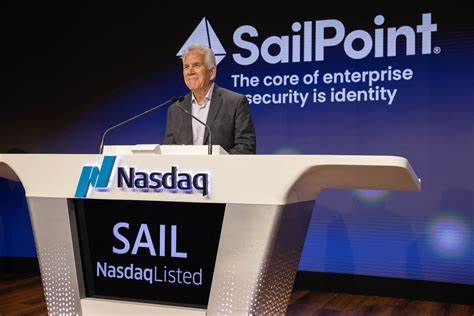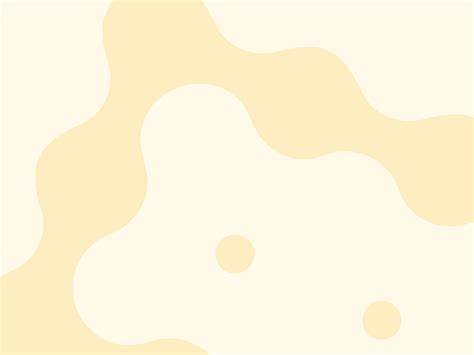In den letzten Jahren ist Veganismus zu einem wichtigen gesellschaftlichen Trend geworden. Viele Menschen entscheiden sich aus ethischen, ökologischen oder gesundheitlichen Gründen für eine pflanzenbasierte Ernährung. Doch immer mehr Studien und Erfahrungsberichte weisen darauf hin, dass Veganer im Durchschnitt höhere Raten von Depressionen und Angstzuständen aufweisen als Nicht-Veganer. Die Frage, warum das so ist, reicht dabei weit über die gesundheitlichen Aspekte wie Nährstoffmängel hinaus. Es geht vor allem um die tiefere psychologische Dynamik, die sich hinter der strikten Identifikation mit dieser Lebensweise verbirgt.
Die Oberfläche der Diskussion wird häufig von der Sorge um mögliche Vitamindefizite wie Vitamin B12 oder Eisen dominiert. Natürlich ist eine unzureichende Nährstoffversorgung ein wichtiger Faktor, der die psychische Gesundheit negativ beeinflussen kann. Doch die Ursachen für die erhöhte Depressionsrate unter Veganern sind vielschichtiger und wurzeln in einem Phänomen, das Psychologen als „Identitätsfusion“ bezeichnen. Dabei verschmelzen persönliche Überzeugungen und Gruppenzugehörigkeiten so stark mit dem Selbstbild, dass jede Abweichung als existenzielle Bedrohung erlebt wird. Diese enge Verknüpfung von Identität und Überzeugungen führt bei vielen Veganern dazu, dass ihre Ernährungsweise nicht einfach eine Lebenseinstellung oder eine bewusste Entscheidung bleibt, sondern zum absoluten Kern dessen wird, was sie zu sein glauben.
Der Veganismus wird zum unverhandelbaren Wesensmerkmal, das Schutz und Zugehörigkeit bildet, gleichzeitig aber auch eine innere Falle ist. Wer sich dann etwa gesundheitlich gezwungen sieht, seine Ernährung anzupassen, empfindet dies nicht nur als reinen Bruch mit einer Gewohnheit, sondern als Verrat am eigenen Ich. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von Sarah, einer Anwältin, die nach einem Dokumentarfilm über Massentierhaltung vegan wurde. Innerhalb kurzer Zeit verwandelte sich ihre Ernährungsweise von einer bewussten Entscheidung in eine rigide Identität. Als sie gesundheitliche Probleme bekam, war es ihr emotional nahezu unmöglich, Kompromisse zuzulassen.
Die Angst, damit nicht mehr „vegan“ zu sein, verursachte mehr Stress als die körperlichen Beschwerden selbst. Die zentrale Frage „Wenn ich nicht vegan bin, wer bin ich dann?“ zeigt die existenzielle Angst, die in dieser Identitätsfixierung liegt. Dieses Phänomen erstreckt sich jedoch weit über den Veganismus hinaus. Immer mehr Menschen fühlen sich durch gesellschaftliche, politische oder spirituelle Standpunkte so definiert, dass ein Abweichen oder ein Infragestellen dieser Positionen als Verlust der eigenen Persönlichkeit empfunden wird. Sei es der Fitness-Enthusiast, der nur noch durch seine Trainingsroutine definiert wird, der Minimalist, der in seiner Lebensweise gefangen ist, oder der engagierte Aktivist, der sich keine Zweifel an seiner Mission erlauben kann.
Die Welt scheint in einem Zustand eingekehrt zu sein, in dem Flexibilität und Zweifel nicht nur als Schwäche gelten, sondern das Gefühl von Zugehörigkeit und Sinn fundamental gefährden. Die vollständige Identifikation mit moralischen oder ideologischen Überzeugungen kann daher als psychologische Gefängniszelle wirken. Sie erzeugt eine allgegenwärtige Angst vor Inkonsistenz, die den Druck steigert, vermeintlich perfekt und fehlerfrei zu sein. Diese Art von rigider Selbstdefinition ist eine starke Quelle von Stress, innerer Verzweiflung und letztlich Depression. Wenn Anpassungsfähigkeit und Selbstmitgefühl fehlen, entstehen hohe persönliche und soziale Kosten.
Eine mögliche Lösung liegt in der Entwicklung dessen, was der Autor „fluide Integrität“ nennt – eine Haltung, bei der Werte und Überzeugungen tief gehalten werden, jedoch ohne dass die Person vollständig mit ihnen identifiziert ist. Fluidität bedeutet nicht Beliebigkeit, sondern die Fähigkeit, sich selbst als das Bewusstsein zu sehen, in dem Überzeugungen entstehen, sich verändern und auch wieder losgelassen werden können. Wer seine Identitäten nicht als unveränderlich oder ultimativ betrachtet, sondern als momentane Ausdrücke eines größeren Selbst, kann variabler auf Lebensveränderungen reagieren und psychisch gesünder bleiben. Das Beispiel von Marcus, einem Veganer, der sich nach gesundheitlichen Schwierigkeiten entschied, zeitweise Fisch in seine Ernährung aufzunehmen, verdeutlicht diese Haltung. Marcus stellte seine persönliche Gesundheit über die strikte Einhaltung einer ideologischen Regel, ohne seinen Wert in der Gemeinschaft zu verlieren.
Diese Ehrlichkeit führte zwar zu teils harscher Kritik, zeigte aber auch, wie wichtig Offenheit und Selbstfürsorge sind, um langfristig psychisch stabil zu bleiben. Die gesellschaftlichen Strukturen, die früher Identität stifteten – wie Familie, Religion oder feste Gemeinschaften – lösen sich zunehmend auf. In dieser Leere entstehen oft neue Ersatzgemeinschaften, deren Zugehörigkeit über ideologische Härte gemessen wird. Dies trifft insbesondere die jüngeren Generationen, die in einer komplexen, schnellen Welt Orientierung suchen. Die Herausforderung besteht darin, in dieser Umbruchphase einen Weg zu finden, um gleichzeitig Halt und Freiheit zu leben.
Psychologisch gesehen ist die Bindung an eine starre Identität eine Schutzmechanismus gegen Unsicherheit und Existenzangst. Doch paradoxerweise erzeugt gerade diese Verbissenheit eine innere Verstärkung dieser Ängste, weil Abweichung als Bedrohung empfunden wird. Flexibilität, sanfte Selbstbeobachtung und die Bereitschaft, eigene Überzeugungen zu hinterfragen, sind deshalb Schlüsselkompetenzen für seelische Gesundheit. Dieser Ansatz ist kein Aufruf zur Beliebigkeit oder moralischem Relativismus, sondern zu einem achtsamen Umgang mit sich selbst. Er fordert heraus, die eigene Praxis und Überzeugungen als Werkzeuge zur Werteverwirklichung zu sehen und nicht als essenzielle Bausteine der eigenen Existenz.
So entsteht Raum zum Wachsen, zur Veränderung und zu mehr Echtheit. Die psychische Belastung, die aus der starren Identifikation entsteht, hat weitere Folgen. Sie verhindert kreative Problemlösungen, da die Verteidigung der eigenen Position wichtiger wird als das Finden von Kompromissen oder realistischen Ansätzen. In der Politik, in Unternehmen oder Familien führen solche Muster zu Blockaden und Konflikten, die vermeidbar wären. Die Wiederentdeckung einer flexiblen, integren Haltung eröffnet daher auch gesellschaftliches Potenzial zur Heilung und Entwicklung.
In der Praxis kann man diese Haltung durch unterschiedliche Methoden fördern. Meditation, Selbstreflexion oder therapeutische Begleitung können helfen, Muster der Identitätsverbissenheit zu erkennen. Ebenso oft ist es das Gespräch mit anderen, die ähnliche Erfahrungen haben, das Mut macht, eigene Überzeugungen zu öffnen. Selbstakzeptanz und die Bereitschaft, sich auch einmal „falsch“ oder veränderlich zu fühlen, stärken die psychische Widerstandskraft. Die Debatte um vegane Ernährung und mentale Gesundheit zeigt exemplarisch, wie vielschichtig Ursachen von Depressionen sein können.