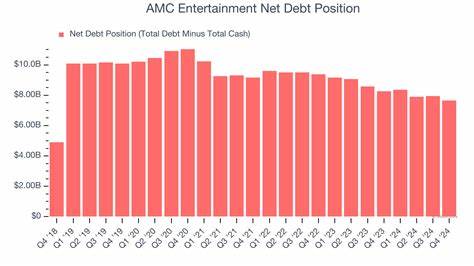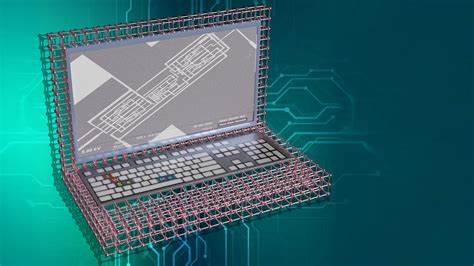Diamanten gelten seit langem als faszinierende Materialien nicht nur wegen ihrer unvergleichlichen Härte und Brillanz, sondern auch aufgrund ihrer einzigartigen optischen und elektronischen Eigenschaften. Eine besondere Rolle spielen dabei sogenannte Farbzentren, also punktförmige Defekte im Diamantgitter, die unter bestimmten Bedingungen einzelne Photonen mit hoher Qualität emittieren können. Diese Eigenschaften machen Farbzentren zu vielversprechenden Bausteinen für die Entwicklung von Quantencomputern, Quantenkommunikationsnetzwerken und empfindlichen Quantensensoren. In den letzten Jahren haben Farbzentren aus Elementen der Gruppe IV, wie Silizium-, Germanium-, Zinn- und Blei-Farbzentren, erhebliches Interesse auf sich gezogen. Besonders hervorzuheben sind dabei die Zinn-Fehlstellenkomplexe (SnV−), die im Vergleich zu den weit verbreiteten Stickstoff-Fehlstellen (NV−) durch ihre hohe Emissionsquantenausbeute im Null-Phonon-Linienbereich und ihre geringe spektrale Fluktuation bestechen.
Die Symmetrieeigenschaften der Gruppe-IV-Defekte reduzieren unerwünschte Streuung und verbessern somit die optische Kohärenz, was essenziell für Anwendungen in der Quantenoptik ist. Ein zentrales Problem bei der Nutzung dieser Farbzentren ist jedoch die kontrollierte und effiziente Positionierung beziehungsweise Aktivierung einzelner Farbzentren. Bislang waren Verfahren wie chemische Gasphasenabscheidung (CVD) oder Hochdruck-Hochtemperatur-Synthesen (HPHT) wenig geeignet, da sie keine präzise Platzierung einzelner Defekte erlauben und oft mit einer heterogenen Verteilung der Defekte einhergehen. Ionimplantation hingegen bietet hier eine erstklassige räumliche Kontrolle und ermöglicht das gezielte Einbringen der gewünschten Fremdatome mit Nanometerpräzision. Ein leidiges Problem bei der Ionimplantation von schweren Atomen wie Zinn ist allerdings die erhebliche Kristalldisperrsion und dadurch entstehende Gitterstörung, die die optischen und spinphysikalischen Eigenschaften der Farbzentren beeinträchtigen können.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat ein Forscherteam unter anderem der Universitäten Oxford, Cambridge und Manchester eine innovative zweistufige Methode entwickelt, die einerseits eine präzise, ortsselektive Ionimplantation von 117Sn ermöglicht und andererseits eine lokale Nachbehandlung mittels Femtosekunden-Laser-Annealing umfasst. Diese Kombination verspricht einen quantensprungartigen Fortschritt in der Skalierbarkeit und Qualität von SnV-Farbzentren. Die Ionimplantation erfolgt mit einer beachtlichen Auflösung von unter 50 Nanometern, die sogar auf weniger als 20 Nanometer gesteigert werden kann. Zudem lässt sich die Menge der eingebrachten Ionen pro Implantationsstelle präzise dosieren – von einigen hundert bis hinunter zu einzelnen Ionen – obwohl hier natürliche statistische Schwankungen durch die Poisson-Verteilung eine Rolle spielen. Im Anschluss an diese Implantation wird die Diamantoberfläche mit ultrakurzen Laserpulsen im Femtosekundenbereich bei einer Wellenlänge von 520 Nanometern behandelt.
Eine entscheidende Innovation dieses Verfahrens ist die In-situ-Überwachung der photolumineszenten Spektren während des Laserprozesses, wodurch die Entstehung einzelner Farbzentren unmittelbar beobachtet und exakt gesteuert werden kann. Die physikalischen Hintergründe dieser Laseraktivierung sind vielschichtig und faszinierend. Die ultrakurzen Laserpulse erzeugen durch Mehrphotonenabsorption freie Elektron-Loch-Paare sowie Anregungen, die rasch eine hohe elektronische Temperatur erreichen, noch bevor das Gitter sich erwärmt. Die nachfolgende Energieübertragung auf das Kristallgitter aktiviert gezielt die Diffusion von Gitterdefekten wie Kohlenstoff-Selbstinterstitialen, ohne dass es zu schädlicher Graphitisierung kommt. Dadurch werden Aubildungen wie das von der Gruppe als „Type II Sn“ bezeichnete SnV-Ci-Komplex angeregt, das als Vorstufe oder Nebenkonfiguration des eigentlichen SnV− Farbzentrums fungiert.
Die Laserbehandlung erlaubt somit eine reversible Umwandlung zwischen diesen verschiedenen Defektzuständen. Die Resultate sind beeindruckend. So konnten einzelne SnV− Farbzentren mit klar charakteristischen Null-Phonon-Linien um 619 Nanometer erzeugt werden, deren optische Übergänge bei niedrigeren Temperaturen eine typisch charakteristische Aufspaltung zeigen. Messungen der Autokorrelationsfunktion belegten die Erzeugung von einzelnen Photonenzentren, die als Einzelphotonenquellen fungieren. Besonders interessant ist die hohe Stabilität dieser Zentren selbst unter intensiver optischer Anregung, was für Quantentechnologie-Anwendungen unabdingbar ist.
Parallel dazu zeigten die Forscher, dass das sogenannte Type II Sn-Defektkomplex eine eigene, optisch aktive Artefaktform von Zinn-basierten Defekten darstellt. Dieser weist eine schmalere Verteilungsbreite der Emissionslinien, eine geringere Aufspaltung der Grundzustände sowie ein anderes Polarisationsverhalten auf, was darauf hindeutet, dass er sich von dem eigentlichen SnV− Farbzentrum strukturell unterscheidet. Dichtefunktionaltheoretische Simulationen bestätigten energetisch stabile Konfigurationen, in denen ein Selbstinterstitialkohlenstoffatom nahe einem SnV− Zentrum verbleibt und so den Typ-II-Zustand erzeugt. Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis ist die Beobachtung dynamischer Wechselwirkungen zwischen diesen Defekttypen während des Laserprozesses, die einen fließenden Übergang zwischen Type II Sn und dem SnV− Zentrum ermöglichen. Mit Hilfe von zeitaufgelöster Photolumineszenz konnten die Aktivierungs- und Deaktivierungsprozesse einzelner Zentren nahezu in Echtzeit verfolgt werden, was die präzise Steuerung der Defektzustände in künftigen Geräten erleichtert.
Durch diese kontrollierte Aktivierung und Steuerung der Farbzentren mittels Femtosekundenlaser unter Berücksichtigung der In-situ-Spektralmessung wird eine neue Dimension der Defekttechnologie in Diamanten erreicht. Im Vergleich zu klassischen Hochtemperaturverfahren bei hohem Druck bietet diese Methode eine schnellere, gezieltere, und umweltverträglichere Alternative, die außerdem die Nanofabrikations-Prozesse im Quantenbereich kompatibel macht. Die Perspektiven für Anwendungen dieser Technologie sind weitreichend. Einzelne SnV− Farbzentren können als hochkohärente Quantenspeicher fungieren oder als einzelne Photonenquellen in Quantenkommunikationsnetzwerken dienen. Die präzise Platzierung erlaubt zudem die Integration in Nanophotonik-Strukturen wie Resonatoren oder Wellenleiter, was die Licht-Materie-Wechselwirkung stärkt und somit die Effizienz und die Funktionalität von Quantenbauelementen verbessert.
Darüber hinaus spricht die größere Spin-Bindung des SnV− Zentrums für höhere Kohärenzzeiten auch bei höheren Temperaturen im Vergleich zu anderen Gruppen-IV-Defekten, was wichtige technologische Fortschritte ermöglicht. Das vorgestellte Verfahren lässt sich zudem ohne großes Umrüsten an andere Gruppe-IV Farbzentren anpassen. Insbesondere die Schaffung von SiV− Zentren mittels ähnlicher Laseraktivierung wurde bereits erfolgreich demonstriert. Die Erforschung weiterer Prozessparameter wie Pulsenergie, Wellenlänge und Pulszahl wird erwartet, die Prozesskontrolle weiter zu optimieren und eine noch höhere Ausbeute bei der Einzelzentrumserzeugung zu erzielen. Zusammenfassend markiert die laserbasierte Aktivierung von Gruppe-IV-Farbzentren in Diamanten eine signifikante technologische Errungenschaft für die Quantenmaterialforschung.
Die Kombination aus hochpräziser Ionimplantation und räumlich selektivem Femtosekunden-Laser-Annealing mit Echtzeit-Feedback bietet eine robuste Plattform, um einzelne Farbzentren zuverlässig und reproduzierbar zu erzeugen. Dies ebnet den Weg für leistungsfähige Quantengeräte, die für Anwendungen von Quantenkommunikation bis hin zu Quantencomputing von zentraler Bedeutung sind und die bislang durch unzureichende Fabrikationsmethoden limitiert waren. Angesichts der zunehmenden Relevanz von Diamantfarbzentren für verschiedene Zukunftstechnologien dürfte dieses innovative Kombinationsverfahren die Forschung und industrielle Entwicklung in diesem Bereich nachhaltig vorantreiben.