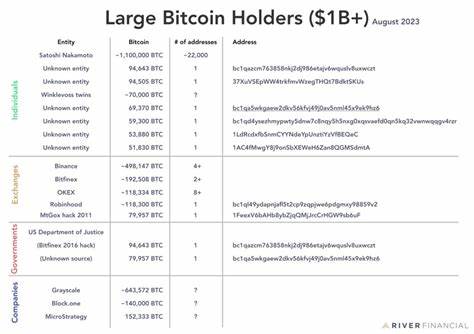Immersive Steinbrüche sind mehr als nur ungewöhnliche Veranstaltungsorte für Kunstausstellungen – sie sind Zeugnisse einer tiefen Verknüpfung von Raum, Geschichte und kreativer Innovation. In Südfrankreich, nahe dem malerischen Dorf Les Baux-de-Provence, liegt ein solcher Ort, dessen Geschichte Millionen von Jahren zurückreicht und der heute als Kulisse für faszinierende immersive Kunsterlebnisse dient. Der ehemals aktive Kalksteinbruch Le Grand Fonds ist zum Sinnbild einer künstlerischen Bewegung geworden, die weit über reine Projektionen hinausgeht und bedeutende Impulse für die Art und Weise gibt, wie Kunst heute erlebt und präsentiert wird. Der Ursprung dieses Phänomens findet sich dabei nicht nur in der modernen Kunstszene, sondern ebenso tief in der Geologie, in Technikgeschichte und kulturhistorischen Entwicklungen. Die geologische Entstehung der Kalksteinbrüche rund um Les Baux-de-Provence begann vor etwa 50 Millionen Jahren, als das Gebiet von den Wasser des prähistorischen Meeres bedeckt war.
Über Jahrtausende lagerten sich riesige Mengen Kalksedimente ab, die schließlich zu massiven Kalksteinformationen verfestigt wurden. Diese Formationen boten später den idealen Rohstoff für den lokalen Steinbruchbetrieb, der im 19. Jahrhundert florierte und den Kalkstein als Baumaterial für die Dörfer und Städte der Region nutzte. Die verlassene Industrieanlage entstand aus einer Kombination von natürlicher Beschaffenheit und technischer Innovation – vor allem durch das Bergbauverfahren "Room and Pillar". Dabei werden große Hohlräume („Rooms“) in horizontalen Ebenen ausgebrochen, während tragende Säulen („Pillars“) aus Kalkstein stehen bleiben, um die Decke zu stützen.
Dieses Verfahren hinterließ eine kalkstein-geformte Architektur mit hohen, kantigen Pfeilern und großzügigen, von Menschenhand geschaffenen Höhlenräumen. Nicht nur Mathematiker und Geologen, sondern auch Künstler sahen schnell das ästhetische und räumliche Potential dieser Räume. 1959 verlieh der avantgardistische französische Künstler Jean Cocteau dem Steinbruch eine neue Bedeutung, indem er ihn als Kulisse für seinen Film Testament of Orpheus nutzte. Die immense Größe und besondere Architekturoptik der unterirdischen Hallen erzeugten ein Gefühl von Monumentalität und surreale Atmosphäre, die Cocteaus Film visuell bereicherte. Nur wenige Jahre später entdeckte der vielseitige Fotograf und Filmschaffende Albert Plećy die eigentümliche Schönheit und die einzigartigen räumlichen Qualitäten der Steinbruchhallen für sich.
Für Plećy waren die Räume nicht nur Bühne, sondern vielmehr Leinwand für eine ganz neue Art der visuellen Erfahrung: der immersive Raum. In der Folgezeit setzte Plećy technologische Mittel ein, die zuvor kaum in dieser Form genutzt wurden. Mit dem Fortschritt der audiovisuellen Technik, insbesondere dank der Einführung von Geräte wie dem Kodak Carousel Model 550 – einem zuverlässigen Diaprojektor mit automatischer Weiterschaltung – begann er, Räume zu schaffen, in denen Kunst nicht nur betrachtet, sondern erlebt, durchschritten und spürbar wurde. Inspiriert von Arbeiten internationaler Kollegen wie dem Architekten Hans-Walter Müller und Bühnenbildner Josef Svoboda, die mit Licht, Schatten und Raum spielten, verwandelte Plećy den Steinbruch Le Grand Fonds 1977 in die Cathédrale d’Images, ein dauerhaftes immersives Kunstzentrum. Die Cathédrale d’Images etablierte ein neuartiges Ausstellungskonzept, bei dem klassische Kunstwerke auf die weitläufigen Steinbruchwände projiziert wurden.
Die Besucher tauchten in Bilderwelten ein, die sich über Decken, Böden und Pfeiler erstreckten. Diese Räume boten ungewöhnliche Landschaften des Sehens und Fühlens, die konventionelle Galerien oft nicht erreichen konnten. Kuratierte Installationen lebten von dem Wechselspiel zwischen den geometrischen Formen des Steinbruchs und den visuellen Inhalten – sei es die Monumentalität von Cocteaus Filmen oder später auch die farbprächtigen Werke Vincent van Goghs. Besonders Van Gogh wurde mit der Immersion im Steinbruch eng verknüpft: Zwar ist sein Name heute sicherlich das Symbol immersiver Kunsterfahrungen weltweit, doch die Verbindung zwischen ihm und dem Steinbruch ist weit älter als die modernen kommerziellen Van Gogh-Ausstellungen. Bereits 1989 fanden im Rahmen der Cathédrale d’Images immersive Van Gogh-Projektionen statt, lange bevor die inzwischen weit verbreiteten „Van Gogh Alive“ Formate auftauchten.
Später führten die Enkelinnen und Nachkommen von Plećy die Tradition weiter. Sie verbanden das Erbe der immersiven Kunst mit neuen Technologien und globaler Verbreitung, was zur heutigen Beliebtheit solcher Ausstellungen beitrug. Die Geschichte der immersiven Steinbrüche ist somit eine Geschichte von Schichten – geologische, künstlerische, technische und gesellschaftliche. Wie die Kalksteinschichten im Boden, scheinen mehrere Einflüsse übereinander zu liegen und bilden einen komplexen Kontext. Von der antiken Formation über die industrielle Nutzung bis hin zum kreativen Wiederbeleben durch Licht und Projektionen findet sich hier eine Symbiose, die viel über den Wandel von Industrie hin zu Kultur aussagt.
Solche Räume erinnern uns daran, dass Kunst nicht immer auf weißen Wänden stattfinden muss, sondern auch – und vielleicht gerade – in ungewöhnlichen Umgebungen gedeihen kann, die von Natur und Technik geprägt sind. Immersive Steinbrüche fungieren damit als besondere kulturelle Orte, die Vergangenheit erlebbar machen und gleichzeitig innovative künstlerische Formate ermöglichen. Der heutige Steinbruch unter dem Namen Carrières de Lumières ist zu einer Touristenattraktion mit großem internationalem Ansehen geworden. Trotz der umfangreichen Modernisierung und neuer Ausstellungskonzepte wird in der Kritik oft bemängelt, dass der Ursprung der Initiative und die Arbeit der frühen Pioniere wie Plećy kaum noch gewürdigt werden. Die Auseinandersetzungen um Rechte, Betrieb und Kommerzialisierung der Location sind Ausdruck eines größeren Trends, in dem kulturelles Erbe, Ökonomie und Kunst in Spannung zueinanderstehen.
Unabhängig davon bleibt die Faszination, die diese Räume ausstrahlen, ungebrochen. Die Kombination aus monumentaler Naturarchitektur, immersiven Projektionen und kunsthistorischer Tiefe schafft Erlebnisse, die Besucher emotional berühren und ihren Blick auf Kunst und Raum erweitern. Interessierte, die sich intensiver mit der Thematik auseinandersetzen möchten, finden vielfältige Ressourcen. Die Buchpublikation Hommes d’Images von Albert Plećy bietet eine seltene Perspektive auf seine Pionierarbeit, während die mehrteilige Forschungsreihe Quarries of Light von María Nieto Sánchez die Entwicklung der immersive Kunst im Steinbruch detailliert dokumentiert. Ergänzend geben internationale Berichte und zeitgenössische Analysen Aufschluss über die wirtschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Entwicklungen, die das Phänomen prägen.
Die immersive Kunst in Steinbrüchen zeigt exemplarisch, wie sich ehemals rein funktionale Räume zu lebendigen Stätten kultureller Innovation wandeln lassen. Sie sind Belege dafür, wie technische Erfindungen, das Spiel mit Licht und Raum sowie das Bewusstsein für Vergangenheit und Gegenwart zusammenfließen, um neue Erlebnisse zu schaffen. Damit sind immersive Steinbrüche ein Symbol für eine Kultur, die das Alte nicht nur bewahrt, sondern aktiv transformiert und neu interpretiert. Zukunftsweisend könnten solche Projekte ein Modell sein, wie Kunst und Raum in symbiotischer Verbindung Realität und Traum miteinander verschmelzen lassen – und zugleich nächste Generationen inspirieren, die Geschichte in einen spannenden Kontext zu setzen.