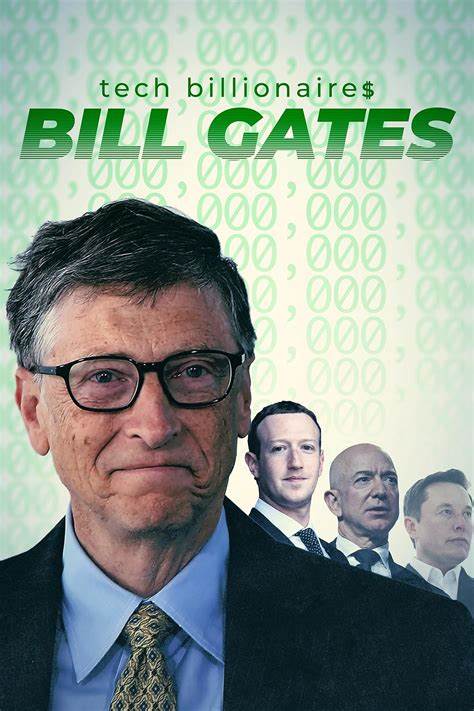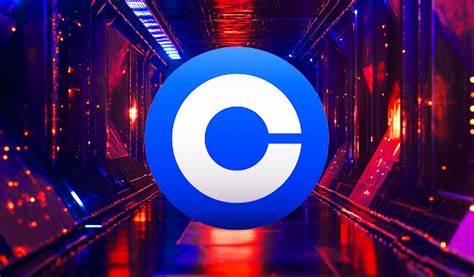In der Welt der Technologie und des Unternehmertums gehören Persönlichkeiten wie Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg zu den einflussreichsten Figuren der Gegenwart. Diese sogenannten „Broligarchen“ dominieren nicht nur wirtschaftliche Landschaften, sondern prägen zunehmend auch gesellschaftliche und kulturelle Diskurse. Überraschenderweise teilen diese Superreichen eine gemeinsame literarische Vorliebe: die Science-Fiction-Reihe „The Culture“ des schottischen Autors Iain M. Banks. Trotz dieser offensichtlichen Wertschätzung sind sie jedoch eher von technologischen Faszinationen angetrieben, während die grundlegenden ideologischen Botschaften der Bücher offenbar weitgehend unberücksichtigt bleiben.
„The Culture“ ist eine futuristische Weltraum-Utopie, die eine post-scarcity Gesellschaft beschreibt – eine Gesellschaft ohne Geld, ohne Mangel und ohne große soziale Ungleichheit. Sie basiert auf Kollektivismus, sozialer Kooperation und liberalen Werten wie Empathie und Pluralismus. Dieser grüne Traum widerspricht fundamental dem heutigen Silicon-Valley-Kapitalismus, in dem Reichtum und Macht in den Händen weniger konzentriert sind und soziale Ungleichheit oft unerwünscht bagatellisiert wird. Iain M. Banks stellt in seinen Romanen eine Welt vor, in der Technologie nicht ein Mittel zur Akkumulation von Macht für Einzelne ist, sondern ein gemeinschaftliches Werkzeug für die Verbesserung der Lebensqualität aller Mitglieder der Gesellschaft.
Dies steht im deutlichen Gegensatz zu den heutigen Praktiken vieler Tech-Giganten, deren Unternehmen häufig mit unionfeindlichen Maßnahmen, Langzeitarbeitszeiten und einer toxischen Unternehmenskultur in Verbindung gebracht werden. Die eingesetzte Technologie soll nicht nur Raumfahrt ermöglichen oder Software verbessern; sie soll dabei helfen, eine offene, freiheitliche Gesellschaft zu erschaffen, die sich weder nach Marktlogik noch nach Akkumulation von Reichtum richtet. Elon Musk ist als der leidenschaftlichste Fan von „The Culture“ bekannt. Er hat technische Innovationen und Konzepte aus Banks’ Werken übernommen, wie die „Neural Lace“ – eine Gedankenverbindungs-Technologie – oder die Namen seiner SpaceX-Drohnenboote, die auf Banks’ Raumschiffen basieren. Dennoch steht Musk politisch und gesellschaftlich an entgegengesetzten Enden des Spektrums im Vergleich zur politischen Philosophie von Banks.
Wo Musk 2018 sich als utopischer Anarchist bezeichnete, zeigte sich in letzter Zeit sein Engagement für schwer zu vereinbarende politische Positionen, wie seine Unterstützung rechter Ideologien und seine aggressive Haltung gegen Gewerkschaften. Diese Diskrepanz illustriert ein grundlegendes Problem: Die Tech-Milliardäre scheinen sich eher von dem futuristischen und technologischen Glamour der Culture-Reihe begeistern zu lassen als von deren sozialistischen und egalitären Prinzipien. Sie zelebrieren die Macht der Technologie als Selbstzweck, welches ihnen eine vermeintliche moralische Legitimation verleiht. Die starke technische Überlegenheit der Culture – von hochtechnisierten Raumschiffen bis zu allmächtigen Künstlichen Intelligenzen – wird fälschlicherweise als Beleg für die Überlegenheit der Nutzer und Hersteller dieser Technologien interpretiert, nicht als Ergebnis eines sozial verantwortlichen, kollektiven Miteinanders. Banks handhabt Technologie nicht als Waffe der Herrschaft oder des Kapitalismus, sondern als Mittel zur Ermöglichung eines guten Lebens für alle.
Die Culture kämpft gegen unmenschliche Gesellschaftsformen, wie beispielsweise Theokratien, Sklaverei und totalitäre Herrschaft, und übernimmt dabei oft eine Art moralische Intervention, um Freiheit und Gleichheit zu sichern. Aufgabe der Kultur ist es, andere Zivilisationen durch Kooperation und Einfühlungsvermögen zu beeinflussen, nicht durch imperialistische Dominanz oder ökonomische Ausbeutung. Für die Tech-Milliardäre, die zunehmend autoritäre Tendenzen und eine Politik der sozialen Spaltung unterstützen, passt diese Botschaft nur schwer ins Bild. Sie haben vielmehr politische Allianzen mit konservativen Kräften gebildet und gelten als Gegner einer Kultur der sozialen Anerkennung und Vielfalt, die in der Culture-Galaxie zentral ist. So zeichnet sich in der realen Welt ein Widerspruch ab zwischen der kultivierten Bewunderung für Banks’ utopische Vision und dem eigenen Verhalten, das oft eine Verschärfung sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten begünstigt.
Darüber hinaus zeigt die Culture-Serie eine Gesellschaft ohne feste Geschlechterrollen, in der Genderfluidität selbstverständlich ist und Gleichstellung tief verankert ist. Diese Aspekte stehen im starken Gegensatz zu den Tendenzen vieler Tech-Firmen, die zuletzt vermehrt Kritik aufgrund von rückwärtsgewandten Gender-Politiken und unzureichender Unterstützung für LGBTQ+-Personen erhielten. Die grundlegenden sozialen Werte der Culture – Offenheit, Akzeptanz und Gleichheit – scheinen den Errungenschaften und der öffentlichen Haltung einiger der führenden Tech-Unternehmer diametral entgegenzustehen. Die Attraktivität der Culture-Reihe für die Tech-Milliardäre liegt demnach primär in der Darstellung modernster Technologie, die als Synonym für Fortschritt, Macht und Zukunft verstanden wird, während die soziale Dimension und die politische Botschaft der Bücher wenig Aufmerksamkeit finden. Die opulente Beschreibung von Raumschiffen, künstlichen Intelligenzen und technologischen Spielereien erzeugt einen Reiz, der sich mit dem eigenen Selbstbild als mächtige Innovatoren im Technologie-Sektor deckt.
Dieses Missverständnis offenbart eine tieferliegende Frage über den Umgang mit Wissenschaft, Technik und Menschlichkeit in der heutigen Zeit. Während die Culture als literarisches Projekt zeigt, dass technologische Überlegenheit nur dann sinnvoll ist, wenn sie der Freiheit und dem Wohl aller dient, konstruieren die broligarchischen Tech-Giganten dagegen eine Vision, bei der Technologie vor allem Macht, Status und Profit sichert – oft zum Nachteil der Gesellschaft. Die Ironie dabei ist, dass die Tech-Milliardäre lediglich die äußere Schale der Culture-Reihe umarmen, während die radikalen Forderungen nach sozialem Wandel ausgeblendet werden. Der Science-Fiction-Autor Banks war bekannt für seine kritische Haltung gegenüber dem Kapitalismus und der Machtkonzentration in den Händen weniger. Seine Werke sind als Warnung zu verstehen, vor einer Gesellschaft, die an Gier, Hierarchien und Ausbeutung zerbricht – eine Welt, die wir in der Realität immer noch beobachten, trotz aller technischen Fortschritte.
Die Bedeutung dieser Diskrepanz geht weit über die Welt der Fiktion hinaus. Sie zeigt, wie kulturelle Referenzen von mächtigen Persönlichkeiten angeeignet werden können, ohne die grundlegenden Standpunkte dieser Werke zu reflektieren. Es ist eine Erinnerung daran, dass Technologie nicht neutral ist und ihre Entwicklung immer von den gesellschaftlichen und politischen Kräften geprägt wird, die sie kontrollieren. Wenn die Tech-Milliardäre tatsächlich eine Gesellschaft wie die Culture anstreben würden, müssten sie ihren eigenen Umgang mit Macht, Politik und Technologie grundlegend überdenken. Die utopische Vision von Iain M.
Banks fordert ein Umdenken gegenüber wirtschaftlichen Strukturen, soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Zusammenarbeit und die Abschaffung von sozialer Ungleichheit – Prinzipien, die in der modernen Tech-Industrie bisher eher marginalisiert sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewunderung für die Culture-Reihe durch einige der mächtigsten Männer in der Technologiebranche eine faszinierende kulturelle Ironie offenbart. Sie zeigt, wie ein Werk, das für soziale Gerechtigkeit und eine gerechte Zukunft steht, von eben jenen missverstanden wird, deren wirtschaftliches Modell genau das Gegenteil fördert. Die wahre Botschaft von Banks’ Science-Fiction-Gesellschaft bleibt somit für die broligarchischen Tech-Milliardäre weiterhin eine Herausforderung – und eine kritische Mahnung für den verantwortungsvollen Umgang mit Macht und Technologie in unserer Zeit.