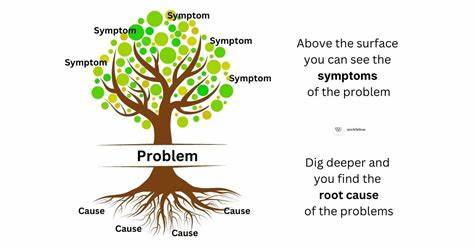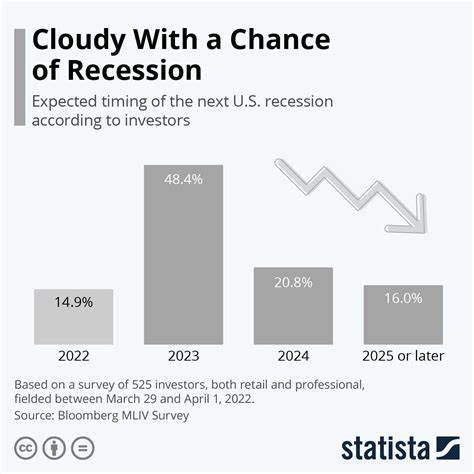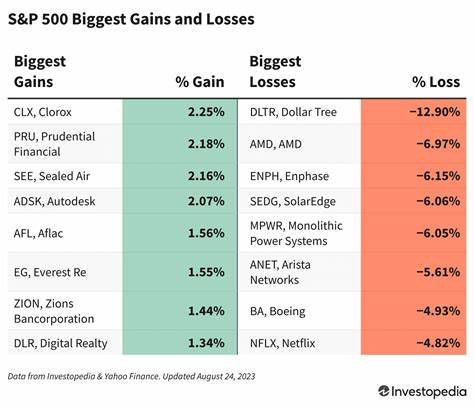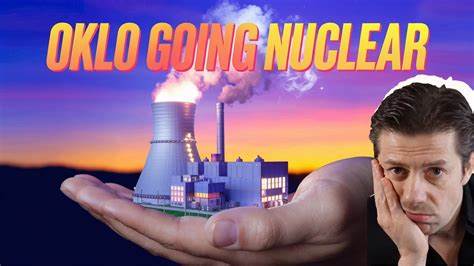Die Analyse von Vorfällen in komplexen Systemen, insbesondere in der Softwareentwicklung und IT-Infrastruktur, hat eine lange Tradition. Häufig steht dabei die sogenannte Root Cause Analysis, kurz RCA, im Mittelpunkt. Die Vorstellung ist simpel und doch verführerisch: Wenn man die „Wurzelursache“ eines Problems identifiziert, kann man diese beheben und damit zukünftige Vorfälle verhindern. Doch diese Annahme erweist sich bei genauer Betrachtung als zu optimistisch und teilweise irreführend. Sie basiert auf der Hoffnung, aus der Vergangenheit eine Vorhersage für die Zukunft abzuleiten – eine Hoffnung, die in komplexen Systemen häufig enttäuscht wird.
Jeder Vorfall entsteht aus einem komplexen Gefüge von Faktoren, die sich hauptsächlich gegenseitig beeinflussen und adaptiv verhalten. Dabei ist es selten möglich, eine einzige Ursache isoliert herauszugreifen, welche die anderen überstrahlt und zur alleinigen Wurzel des Problems erklärt werden kann. Die Realität ist vielschichtiger: Zahlreiche kleine, teils unscheinbare Faktoren können in unterschiedlichen Situationen gemeinsam den Auslöser für einen Vorfall bilden. Eine zu enge Fokussierung auf einzelne vermeintliche Kernursachen verführt dazu, andere Risiken und potenzielle Schwachstellen zu übersehen. Die traditionelle RCA impliziert, dass man aus einem vergangenen Ereignis klare Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen kann.
Es wird angenommen, dass das Eliminieren der Wurzelursache einen nachhaltigen Effekt auf die Verfügbarkeit und Stabilität des Systems hat. Diese Annahme führt oft zu einer falschen Sicherheit. Erfahrungsgemäß verläuft die Entwicklung von Vorfällen nicht linear und logisch, sondern ist geprägt von Überraschungen und unerwarteten Zusammenhängen. Ganz gleich, wie gründlich die Analyse ist, die Zukunft bleibt in Bezug auf Ursachen und Auslöser unvorhersehbar. Der Grund dafür liegt in der inhärenten Komplexität moderner Systeme.
Softwarearchitekturen sind dynamisch, Konfigurationen ändern sich, Teams rotieren, und unerwartete Wechselwirkungen zwischen Komponenten können jederzeit neue Risiken hervorbringen. Das, was in einem Vorfall als „Wurzelursache“ bestimmt wird, mag in einem anderen Kontext vielleicht irrelevant sein, während ein vorhin harmloser Faktor plötzlich zum entscheidenden Auslöser wird. Das bedeutet, dass die Fixierung auf eine einzige Ursache bei der Bewertung von Risiken und der Planung von Verbesserungsmaßnahmen oft nicht zielführend ist. Ein weiterer kritischer Punkt liegt in der menschlichen Tendenz, mit dem Rückblick Ereignisse linear zu erklären. Hindsight Bias – die Verzerrung durch Wissen über das Ergebnis – lässt uns eine Geschichte konstruieren, die zwar plausibel, aber nicht notwendigerweise zukunftsprognostisch valide ist.
Die Erklärungen erscheinen klar und kohärent, doch sie sind erst im Nachhinein entstanden und können die tatsächliche Komplexität verschleiern. Aus diesem Grund raten Experten zunehmend dazu, von einer zu engen Ursachenforschung Abstand zu nehmen und stattdessen eine breitflächige Betrachtung der Risikofaktoren zu fördern. Statt zu versuchen, eine „Wurzel“ herauszufiltern, sollte man das Augenmerk auf die Dynamik von Systemen und die Wechselwirkungen zwischen deren Komponenten richten. Die Identifizierung möglichst vieler beitragender Faktoren und die Entwicklung von Resilienzstrategien gegenüber Überraschungen ermöglichen eine robustere Verbesserung der Systemstabilität. Dieser Ansatz hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Nachbesprechungen von Vorfällen gestaltet werden.
Die klassische RCA mit ihren Fokus auf starre Fehlerketten sollte durch eine Analyse ersetzt werden, die auf Vielfalt und Vielfalt der Einflussfaktoren setzt. Die Aufzeichnung und das Teilen von umfangreichen Kontextinformationen helfen dabei, Muster zu erkennen, die ansonsten möglicherweise übersehen würden. Dadurch entsteht ein reichhaltigeres Bild des Risikoumfelds, das langfristig bessere Steuerungsmöglichkeiten bietet. Gerade weil keine Vorhersehbarkeit gewährleistet werden kann, ist es sinnvoll, sich auf die Vorbereitung von unvorhergesehenen Ereignissen zu konzentrieren. Resilienz, also die Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft von Systemen und Teams, rückt damit in den Vordergrund.
Trainings, Szenarioübungen, das Fördern von autonomer Problemlösungsfähigkeit und redundante Systeme sind Maßnahmen, die helfen, auch auf Überraschungen effektiv zu reagieren. Somit wird nicht nur versucht, einzelne Schwachstellen auszumerzen, sondern das gesamte System widerstandsfähiger gegenüber Veränderungen und Störungen gemacht. Ein wichtiges Argument gegen die Suche nach der vermeintlichen Wurzelursache ist auch die Tatsache, dass das letzte Ereignis bereits geschehen ist. Es kann in seiner konkreten Form nicht mehr verhindert werden. Die wertvollen Erkenntnisse liegen darin, die Reaktion und die Anpassungsfähigkeit für zukünftige Herausforderungen zu verbessern, ohne sich an einer einzigen Ursache festzubeißen.
Das Bewusstsein, dass jedes Ereignis anders ist und Überraschungen die Regel bleiben, fördert einen flexiblen Umgang mit Unsicherheit. Kritiker dieser Sichtweise weisen zurecht darauf hin, dass das Lernen aus Fehlern und die Suche nach Ursachen notwendig sind, um Fortschritte zu erzielen. Auch wenn Perfektion unerreichbar ist, verbessert Wiederholung und kontinuierliches Lernen die Bedingungen im System. Die Erkenntnis muss allerdings sein, dass Lernen nicht bedeutet, die Zukunft exakt vorherzusagen, sondern besser mit Unsicherheiten umzugehen. Eine starke Kultur des Lernens und der Offenheit für vielfältige Ursachen ist damit entscheidender als die Fixierung auf einen vermeintlichen Hauptverursacher.