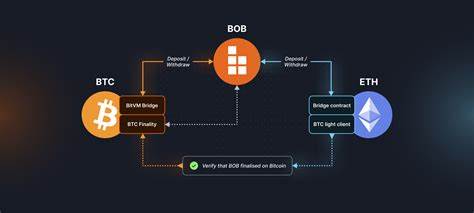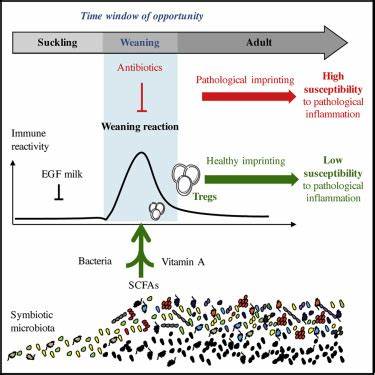Stablecoins gehören zu den faszinierendsten Innovationen der Kryptowährungswelt. Sie versprechen Stabilität in einer oft volatilen Krypto-Landschaft, indem sie ihren Wert an traditionelle Währungen wie den US-Dollar koppeln. Doch trotz des Anspruchs, eine sichere Brücke zwischen digitalen Assets und traditionellen Finanzmärkten zu sein, könnten Stablecoins andere Märkte destabilisieren. Die jüngsten Forschungen von Ökonomen aus renommierten Institutionen wie der University of Pennsylvania, Columbia University und der Chicago Booth deuten darauf hin, dass diese sogenannten stabilen Kryptowährungen nicht so stabil sind, wie ihr Name vermuten lässt – und dass ihr Einfluss auf das Finanzsystem weitreichender sein könnte als bisher vermutet. Stablecoins sind meist an den US-Dollar gebunden und durch verschiedenste Vermögenswerte gedeckt, darunter US-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen.
Diese Bindung soll den Token eine verlässliche Bewertung geben und Volatilität minimieren. Nach dem Prinzip von Geldmarktfonds können diese digitalen Vermögenswerte manchmal jedoch unter den Nennwert, meist einen Dollar, fallen, was zu Panikverkäufen und so genannten Feuerverkäufen von Sicherheiten führen kann. Schon 2021 und 2022 analysierten Forscher das Verhalten der größten US-Dollar-gestützten Stablecoins und fanden heraus, dass das Risiko von Runs, also einem plötzlichen massenhaften Rückzug von Nutzern, erheblich ist. Die Volumina von Stablecoins sind in den letzten Jahren exponentiell gewachsen. Von knapp 5,6 Milliarden US-Dollar Anfang 2020 stieg die Marktkapitalisierung bis Anfang 2022 auf über 130 Milliarden US-Dollar an.
Dieses rasante Wachstum in Kombination mit fehlender Regulierung wirft wichtige Fragen über die Stabilität und die potenziellen Gefahren von Stablecoins auf. Während Regulierungsbehörden wie die US-Notenbank Fed eine stärkere Kontrolle empfehlen, blieb eine konkrete Regulierung bislang aus, was das Risiko für Finanzmarktteilnehmer erhöht. Eine bedeutende Rolle bei der Stabilität der Stablecoins spielen sogenannte Arbitrageure. Diese Akteure kaufen und verkaufen Stablecoins, um deren Preis konstant zu halten, indem sie nach Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Handelsplätzen suchen. Die Forschung zeigt, dass die Anzahl der Market-Maker, die direkt mit den Hauptausgebern der Stablecoins interagieren können, überraschend gering ist.
Diese geringe Anzahl kann eine doppelte Wirkung entfalten: Einerseits sorgt sie für weniger Wettbewerb und damit weniger Effizienz in der Preisstabilisierung, andererseits reduziert sie aber auch das Risiko eines Run-Verhaltens, da weniger Marktteilnehmer bereit sind, massenhaft zurückzukaufen oder zu verkaufen. Ein zentraler Aspekt der Forschung bezieht sich auf die Liquidität der zugrundeliegenden Vermögenswerte, mit denen die Stablecoins gedeckt sind. Während Circle, einer der wichtigsten Stablecoin-Ausgeber, hauptsächlich sehr liquide US-Staatsanleihen hält, besitzt Tether eine diversifizierte aber weniger liquide Asset-Basis, die unter anderem Unternehmensanleihen beinhaltet. Diese Unterschiede sind entscheidend, denn Illiquidität kann dazu führen, dass bei einem plötzlichen Auszahlungsdruck Vermögenswerte nur zu einem stark reduzierten Preis verkauft werden können, was den Wert der Stablecoins weiter unter Druck setzen könnte. Im Vergleich zu klassischen Bankruns, bei denen Sparer ihr Geld gleichzeitig abheben möchten, können Stablecoins erhebliche Auswirkungen auf das Gesamtfinanzsystem haben.
Ein möglicher Plötzlicher Ausstieg aus Stablecoins in großem Umfang könnte zu einer Kettenreaktion führen, in der Vermögenswerte in traditionellen Finanzmärkten, insbesondere im Bereich der Staats- und Unternehmensanleihen, blitzschnell auf den Markt geworfen werden. So zeigt ein Szenario der Forscher, dass ein Run auf Tether den Verkauf von Staatsanleihen im Umfang eines Sechstels dessen verursachen könnte, was während der COVID-19-Panik im März 2020 auf dem Markt durch Geldmarktfonds liquidiert wurde. Diese Situation könnte die Märkte erheblich destabilisieren und zu einem Rückgang der Preise von US-Staatsanleihen und anderen festverzinslichen Papieren führen. Darüber hinaus würde dies Unsicherheiten im gesamten Finanzsystem schüren, was wiederum die Kreditvergabe der Banken beeinträchtigen und sich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken könnte. Besonders alarmierend ist die Tatsache, dass Stablecoins trotz ihrer Bedeutung bislang kaum reguliert sind und viele Anleger die potenziellen Risiken nicht vollständig verstehen oder wahrnehmen.
Vor diesem Hintergrund diskutieren die Forscher auch Maßnahmen, die das Risiko von Runs vermindern könnten. Dazu zählt die Einführung von Einlösegebühren, die Arbitrageure bezahlen müssten, um Stablecoins gegen den US-Dollar einzutauschen. Eine moderate Gebühr könnte die Zahl der Anreize für panikartige Verkäufe reduzieren, ohne den Handel über Gebühr einzuschränken. Ebenfalls wird vorgeschlagen, dass stabile Stablecoins Anlegern Dividenden zahlen könnten, um deren Bindung an die Coins zu erhöhen und somit die Volatilität einzudämmen. Die Regulierung spielt eine Schlüsselrolle bei der Stabilisierung von Stablecoins und ihrer Integration in das bestehende Finanzsystem.
Regulierungsbehörden weltweit stehen derzeit vor der Herausforderung, angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen, die Innovationen nicht behindern, aber gleichzeitig die Finanzstabilität schützen. Transparentere Berichterstattungspflichten, die Anforderungen an die Liquidität der Sicherheiten und ein klar definiertes Krisenmanagement sind wichtige Maßnahmen, die diskutiert und umgesetzt werden müssen. Es ist unabdingbar, dass sowohl Investoren als auch Banken, Aufsichtsbehörden und Stablecoin-Ausgeber die Risiken kennen und entsprechende Strategien entwickeln. Für Anleger bedeutet dies, sich bewusst zu machen, dass ein Stablecoin keine Garantie für Wertstabilität ist, wie ein Sparkonto oder ein Staatsanleihefonds. Für den Finanzmarkt insgesamt stellt sich die Herausforderung, wie diese digitalen Vermögenswerte integriert werden können, ohne die Stabilität zu gefährden.
Abschließend lässt sich festhalten, dass Stablecoins trotz ihres scheinbar stabilen Charakters ein erhebliches Risiko für die Finanzmärkte bergen können. Die Parallelen zu Bankruns und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft sind deutlich erkennbar und legen nahe, dass eine umfassende Überwachung und Regulierung notwendig sind. Nur so kann das volle Potenzial von Stablecoins als verlässliches digitales Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel genutzt werden, ohne dabei andere Märkte und das Finanzsystem als Ganzes zu gefährden. Die Zukunft der Stablecoins wird somit nicht nur von technologischen Innovationen abhängen, sondern vor allem von einer ausgewogenen und klugen Regulierung, die Risiken minimiert und Vertrauen schafft.