Die Finanzierung von Wissenschaft und Forschung bildet das Fundament für Fortschritt, Wachstum und gesellschaftlichen Wohlstand. Trotz der enormen Bedeutung der wissenschaftlichen Arbeit ist die finanzielle Ausstattung in Deutschland und vielen anderen Ländern seit Jahren unzureichend. Tatsächlich war die Forschungsförderung bereits vor den jüngsten Kürzungen weit hinter dem zurück, was nötig wäre, um globale Herausforderungen wirksam zu meistern und technologische Führungsrollen zu sichern. Es wird immer deutlicher, dass eine alleinige Rückkehr zu den früheren Finanzierungsniveaus nicht mehr ausreicht. Es braucht eine tiefgreifende Aufstockung der Mittel – und zwar in einem Ausmaß, das bislang kaum diskutiert wird.
Experten und Entscheider sprechen von einer Verdreifachung der aktuellen staatlichen Investitionen, um die Innovationskraft nachhaltig und effektiv zu stärken. Doch warum ist der Status quo bei weitem nicht ausreichend? Und welche Chancen bietet ein solch ambitionierter Ausbau der Fördermittel? Die Antwort liegt in den vielfältigen positiven Auswirkungen, die eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Wissenschaft mit sich bringt, sowohl für unser Gesundheitssystem, die Wirtschaft als auch für gesellschaftliche Zukunftsfragen. Ein besonders drängendes Thema ist die Lebensverlängerung und Gesundheitsforschung. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland liegt derzeit bei etwa 80 Jahren. Doch wie lässt sich dieses Durchschnittsalter nachhaltig erhöhen, damit mehr Menschen gesund und aktiv weit über die hundert Jahre hinaus leben können? Medizinische Durchbrüche, wie die heilende Wirkung von CRISPR-Technologien bei genetisch bedingten Krankheiten, sind heute schon Realität.
Diese Fortschritte wären ohne öffentliche Forschungszuschüsse, wie etwa durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), nicht möglich gewesen. Private Investoren scheuen sich oft vor derart risikoreichen und langfristigen Projekten, die neben einer enormen Komplexität auch hohe Anfangskosten mit sich bringen. Eine intensivere staatliche Förderung würde die Erfolgsaussichten solcher Forschungsvorhaben erhöhen, indem sie den nötigen Nährboden für innovative Ideen schafft. Hier entsteht nicht nur medizinischer Nutzen, sondern auch ein bedeutender ökonomischer Mehrwert durch die Entstehung neuer Branchen und Arbeitsplätze. Die Bedeutung von Forschung für die nationale Sicherheit und Verteidigung ist ebenso unbestritten.
Technologische Vorreiterrolle sichert heute weit mehr als nur wirtschaftliche Vorteile: Sie definiert Machtverhältnisse und Einflussbereiche weltweit neu. Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Robotik oder Raumfahrttechnologien sind die strategischen Sektoren von morgen, deren Beherrschung über die Position einer Nation in globalen Machtgefügen entscheidet. Während Länder wie China ihre Forschungsaufwendungen innerhalb von zwei Jahrzehnten signifikant vervielfacht haben, stagniert die staatliche Finanzierung in Deutschland und vielen westlichen Staaten weitgehend. Dieses Ungleichgewicht ist nicht nur ein Wirtschaftsproblem, sondern stellt eine reale Gefahr für die geopolitische Stabilität und den Schutz nationaler Interessen dar. Nur durch eine massive Erhöhung der Mittel auf Bundesebene können technologische Innovationen beschleunigt und abgewartete Führungspositionen zurückgewonnen werden.
Neben Sicherheit und Gesundheit ist die wirtschaftliche Wirkung von Forschung besonders beeindruckend. Wissenschaftliche Investitionen gehören zu den profitabelsten überhaupt und erzielen oft Renditen, die deutlich über denen klassischer Anlageformen liegen. Studien weisen darauf hin, dass öffentliche Forschungsförderung eine jährliche soziale Rendite von etwa zwanzig Prozent erreicht – ein Wert, der den durchschnittlichen Aktienmarkt weit übertrifft. Mit steigenden Investitionen wächst nicht nur das Innovationspotenzial, sondern auch das Bruttoinlandsprodukt (BIP), da neue Technologien die Produktivität in zahlreichen Branchen erheblich verbessern. Historisch betrachtet führte technologischer Fortschritt immer wieder zu signifikanten Wohlstandszuwächsen und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Gesellschaften effizienter arbeiten und qualitativ besser leben können.
Ohne kontinuierliche Innovation droht hingegen eine wirtschaftliche Stagnation, die sich durch sinkende Löhne und rückläufige Wettbewerbsfähigkeit bemerkbar macht. Innovation beeinflusst ebenfalls das alltägliche Leben in vielerlei Hinsicht. Fortschrittliche Technologien vereinfachen Aufgaben, reduzieren Kosten und schaffen neue Freizeitmöglichkeiten. Ein Beispiel hierfür sind Entwicklungen im Bereich selbstfahrender Fahrzeuge oder intelligente Haushaltsgeräte, die den Alltag bequemer und sicherer machen. Höhere Forschungsförderung ist somit auch eine Investition in den Lebenskomfort der Bürgerinnen und Bürger.
Die Zukunft hält eine Vielzahl von Lösungen bereit, die unser Leben grundlegend verbessern können – vorausgesetzt, es wird ausreichend in deren Erforschung investiert. Ein weiterer relevanter Aspekt ist die Fähigkeit einer Gesellschaft, auf unerwartete Krisen zu reagieren. Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine ausgeprägte wissenschaftliche Infrastruktur für Früherkennung, Bekämpfung und Heilung von Krankheiten ist. Aber auch andere Bedrohungen, wie Antibiotikaresistenzen, Naturkatastrophen oder Umweltprobleme, erfordern kontinuierliche Forschung. Angemessene Fördermittel dienen hier als eine form von „Versicherung“ für unvorhersehbare Risiken.
Wissenschaftliche Fortschritte ermöglichen es, Lösungen frühzeitig zu entwickeln und damit Schäden oder Kosten massiv zu reduzieren. Nicht zuletzt ist die Forschung ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der direkt und indirekt zahlreiche Arbeitsplätze schafft. Öffentliche Investitionen finanzieren nicht nur Forscher:innen selbst, sondern gewährleisten auch Nachfrage nach Ausrüstung, Material, Infrastruktur und Dienstleistungen. Eine Studie verdeutlicht, dass pro investiertem Euro oft das Doppelte an wirtschaftlicher Aktivität entsteht und auch in strukturschwächeren Regionen neue Jobs entstehen. Die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze ist entscheidend für eine moderne Gesellschaft, insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung und Automatisierung, die viele traditionelle Berufsbilder verändern.
Die Frage, wie viel mehr investiert werden sollte, stellt sich unweigerlich. Vergleiche mit anderen Nationen und historischen Phasen großer Forschungsoffensiven zeigen, dass eine Verdreifachung der derzeitigen Mittel sinnvoll wäre. Als Referenz dient oft die sogenannte Space Race-Ära, als die USA rund zehn Prozent ihres Bundeshaushalts in F&E investierten – circa dreimal so viel wie heute. Um global mithalten zu können, liegt der Gesamtumfang der US-amerikanischen Forschungsausgaben bei etwa 900 Milliarden US-Dollar jährlich. China hat seine Aufwendungen in den vergangenen Jahren exponentiell angehoben und nähert sich diesem Niveau schnell an.
Deutschland muss demgegenüber seine finanzielle Ausstattung deutlich steigern, damit Innovationen erfolgreich vorangetrieben werden können und Abhängigkeiten von anderen Innovatoren – beispielsweise bei Halbleitern oder Energiespeichersystemen – vermieden werden. Nationale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit hängen direkt von der Stärke der eigenen Forschungslandschaft ab. Darüber hinaus ist die Umwelt ein zentraler Innovationsbereich, der enorme Mittel benötigt. Der Klimawandel und die damit verbundenen Herausforderungen erfordern Technologien, die nachhaltiges Wachstum trotz begrenzter Ressourcen ermöglichen. Von effizienten Energiespeichern über grüne Wasserstofftechnologien bis hin zur CO₂-Entfernung aus der Atmosphäre – all diese Projekte sind essenziell für eine lebenswerte Zukunft.
Öffentliche Forschungsgelder sind der Schlüssel, um diese Maßnahmen auf ein drängendes, marktreifes Niveau zu heben und zugleich globale Umweltverpflichtungen erfüllen zu können. Technologieführerschaft bietet weiterhin eine internationale Hebelwirkung. Länder, die an der Spitze der Entwicklung stehen, genießen nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch diplomatische und finanzielle Einflussmöglichkeiten. Der technologische Vorsprung ist ein entscheidendes Mittel der Außenpolitik und des wirtschaftlichen Austauschs. Für Deutschland und Europa gilt es daher, diese Führungsrolle auszubauen und zu sichern, um Wettbewerbsnachteile und geostrategische Verluste zu vermeiden.
Die dreißigjährige Diskussion über die beste Art der Forschungsförderung muss jetzt konkreten Taten weichen. Es braucht innovative politische Konzepte, die Föderalismus, private Investitionen und internationale Zusammenarbeit verbinden, um noch mehr Mittel effizient dort einzusetzen, wo sie den größten nachhaltigen Effekt erzielen. Auch eine verstärkte Transparenz und gezielte Evaluierung können sicherstellen, dass das Geld wirksam investiert wird. Doch das wichtigste ist der Wille, den notwendigen finanziellen Spielraum zu schaffen, bevor es zu spät ist. Zusammenfassend ist die Steigerung der Wissenschaftsfinanzierung nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit.
Gesellschaftlicher Fortschritt, wirtschaftliche Stärke, nationale Sicherheit und eine lebenswerte Zukunft sind ohne eine substantielle und dauerhafte Erhöhung der öffentlichen F&E-Ausgaben kaum noch vorstellbar. Die Zukunft unserer Gesellschaft und Wirtschaft hängt entscheidend davon ab, dass wir die Wissenschaft als zentralen Hebel begreifen und entsprechend fördern – und zwar deutlich mehr als heute.



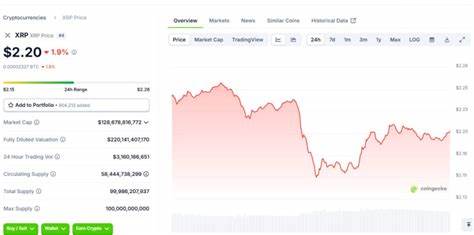
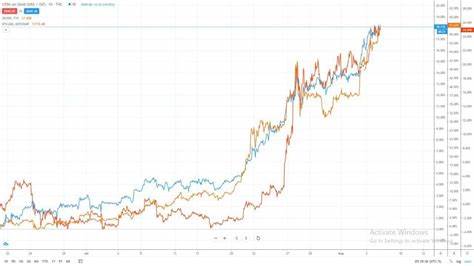



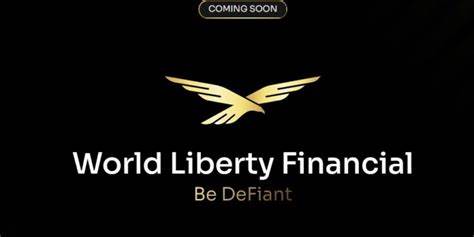
![Tutorial: How to File the Edge Off a MacBook Pro [video]](/images/8193EEA0-CD1B-4B5C-9913-DFACCB2F3B2A)