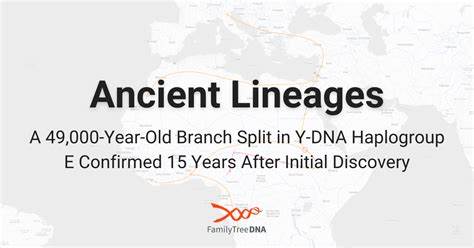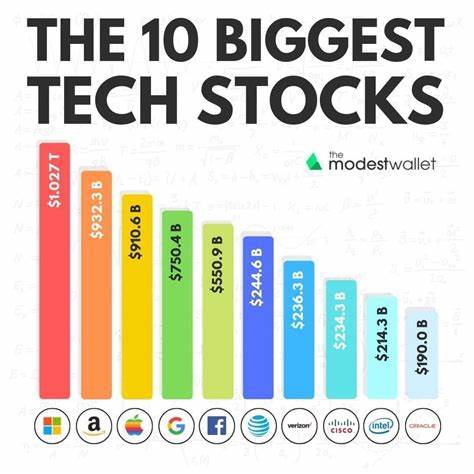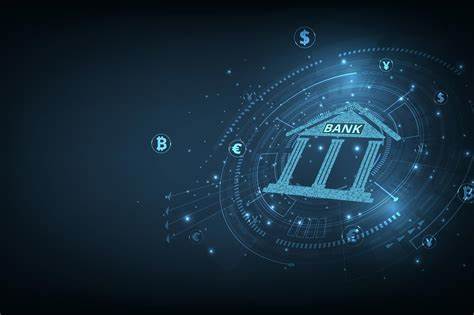Die Sahara, heute als die größte heiße Wüste der Welt bekannt, war einst ein lebendiges, grünes Ökosystem – eine Landschaft voller Savannen, Flüsse und Seen. Diese sogenannte Grüne Sahara-Periode, auch als Afrikanische Feuchtzeit (African Humid Period, AHP) bezeichnet, erstreckte sich vom späten Pleistozän bis ins mittlere Holozän, etwa 14.500 bis 5.000 Jahre vor heute. Während dieser Zeit bot die Sahara ideale Lebensbedingungen für Menschen und Tiere und ermöglichte die Entstehung komplexer Kulturen und Lebensweisen.
Durch bahnbrechende Studien an antiker DNA aus der Grünen Sahara öffnet sich nun ein Fenster in die genetische Vergangenheit der Menschen Nordafrikas und enthüllt eine bislang unbekannte, eigenständige Abstammungslinie, die für das Verständnis der menschlichen Geschichte in dieser Region von großer Bedeutung ist. In den vergangenen Jahrzehnten war die Erforschung der frühen menschlichen Populationen in der Sahara aufgrund der schwierigen klimatischen Bedingungen und der damit verbundenen schlechten DNA-Erhaltung immer eine Herausforderung. Nur selten blieb genetisches Material intakt genug, um tiefgehende genomweite Analysen zu ermöglichen. Die Entdeckung und Analyse zweier etwa 7.000 Jahre alter Frauen, deren Überreste in der Takarkori-Felsunterkunft im südwestlichen Libyen entdeckt wurden, stellt daher einen Meilenstein dar.
Sie brachten neue Einblicke in die genetische Zusammensetzung der damaligen Bevölkerungen und deren Beziehung zu anderen Urgruppen Nord- und Westafrikas sowie darüber hinaus. Die genetischen Analysen zeigen, dass die Takarkori-Individuen eine zuvor unbekannte nordafrikanische genetische Abstammungslinie darstellen, die sich bereits früh vom sub-saharischen und anderen afrikanischen Genpool abzweigte. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Linie ungefähr zur gleichen Zeit entstand wie jene der heutigen Menschen außerhalb Afrikas, dennoch aber über lange Zeit isoliert blieb. Diese Isolation hat dazu geführt, dass sich eine einzigartige genetische Signatur herausbildete, die von den meisten sub-saharischen Populationen genetisch deutlich getrennt ist. Darüber hinaus weisen die Takarkori-Proben enge genetische Verbindungen zu den etwa 15.
000 Jahre alten Jägern und Sammlern aus der Taforalt-Höhle in Marokko auf, die mit der Iberomaurusischen Steinwerkzeugindustrie assoziiert sind. Diese Jäger und Sammler lebten also bereits lange vor der Grünen Sahara-Periode und bilden gemeinsam mit den Takarkori-Menschen eine genetische Kontinuität, die sich über Jahrtausende erstreckte. Die Ähnlichkeit der genetischen Profile der beiden Gruppen unterstützt die Hypothese einer stabilen, autochthonen nordafrikanischen Population, die nicht maßgeblich durch Gene aus dem sub-saharischen Raum beeinflusst wurde. Interessanterweise zeigen die Analysen nur einen sehr geringen Einfluss von genetischem Material aus dem Nahen Osten, welches von Neolithikern und früheren Bauern aus der Levante während des mittleren Holozäns eingebracht wurde. Diese geringe genetische Vermischung spricht dafür, dass die Ausbreitung der Viehzucht im zentralen Sahara-Raum eher durch kulturellen Austausch als durch die Migration ganzer Bevölkerungsgruppen erfolgte.
Die Verbreitung der Viehzucht und pastoralen Lebensweisen erfolgte folglich wahrscheinlich durch die Übernahme von Wissen und Techniken innerhalb der isolierten nordafrikanischen Gemeinschaften, anstatt dass neue genetische Linien massiv in die bereits bestehenden Populationen eingedrungen wären. Darüber hinaus zeigt die Genomstudie, dass während der Grünen Sahara-Periode offenbar kaum genetischer Austausch zwischen den nördlichen und südlichen Teilen Afrikas stattfand, obwohl das damalige Klima als förderlich für Bewegung und Austausch hätte gelten können. Die Sahara fungierte somit trotz der grünen Bedingungen weiterhin als Barriere, kulturell und genetisch. Dies erklärt, warum die genetischen Linien der Takarkori-Individuen kaum Bezüge zu sub-saharischen Gruppen aufweisen, sondern im Wesentlichen eine eigenständige nordafrikanische Herkunft widerspiegeln. Die Ergebnisse sind auch im Kontext der Neandertaler-DNA interessant.
Während heutige Menschen außerhalb Afrikas einen Anteil an Neandertaler-Erbgut tragen, ist dieser bei den Takarkori-Menschen deutlich reduziert. Sie haben etwa zehnmal weniger Neandertaler-DNA als Neolithiker aus dem Nahen Osten, aber dennoch mehr als zeitgenössische sub-saharische Gruppen. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass die Takarkori-Bevölkerung nur leicht mit Populationen außerhalb Afrikas genetisch verbunden war oder eine sehr frühe Verwandschaft mit Menschen hatte, die den afrikanischen Kontinent verlassen hatten. Mit modernen genetischen Methoden wurde auch das mitochondriale Erbgut (mtDNA) untersucht, welches nur mütterlicherseits weitergegeben wird. Die beiden untersuchten Individuen trugen eine basale Linie des Haplogruppe N, eines der ältesten Linien-für-mitochondriale DNA außerhalb Subsahara-Afrikas.
Deren Alter wird auf über 60.000 Jahre geschätzt, was darauf hindeutet, dass diese Linie lange vor der Grünen Sahara in Nordafrika präsent war. Diese Erkenntnis unterstützt die Theorie, dass Nordafrika nicht nur ein Durchgangsgebiet für Auswanderer war, sondern eine eigenständige Region mit tief verwurzelten menschlichen Populationen darstellte. Die archäologische Fundstätte Takarkori gibt zudem wertvolle Einblicke in die frühe Lebensweise der Menschen mitten in der Sahara, die während der Afrikanischen Feuchtzeit von einem grünen, lebendigen Umfeld geprägt war. Hier wurden neben menschlichen Überresten auch Werkzeuge, Keramiken, Tierknochen und pflanzliche Reste gefunden, die ein Bild von mobilisierten Jägern und Sammlern bis hin zu sesshaften oder zumindest semi-nomadischen Viehzüchtern zeichnen.
Diese Funde bestätigen, dass sich in der Grünen Sahara komplexe Gesellschaften entwickelt hatten, die das Leben an die veränderlichen Umweltbedingungen anpassten. Interessanterweise zeigt die archäologische und genetische Evidenz, dass die frühe Viehzucht wahrscheinlich zuerst über die Sinai- und Rotmeer-Routen nach Nordafrika gelangte und sich anschließend schnell bis in die zentrale Sahara ausbreitete. Dies passt zur genetischen Beobachtung, dass Levante-assoziierte Genelemente nur in geringem Maße in der Takarkori-Population auftauchen. Die kulturelle Verbreitung der Viehzucht wurde demnach vermutlich hauptsächlich durch Wissensaustausch und die Adoption neuer Praktiken in bestehenden Populationen möglich, nicht durch eine großflächige Migration neuer Bevölkerungsgruppen. Die Erkenntnisse dieses Forschungsprojekts eröffnen zudem neue Perspektiven für das Verständnis der demografischen Prozesse in Nordafrika, die sich über Jahrtausende hinweg abspielten.
Sie zeigen, dass die Region des Grünen Sahara-Gebiets eine besondere Rolle als genetischer Hotspot mit eigenständiger Entwicklung spielte – eine Situation, die zuvor so detailliert nicht bekannt war. Die Vorstellung, dass die Sahara lediglich als Barriere zwischen sub-saharischen und nordeuropäischen oder nahöstlichen Gruppen fungierte, wird durch die entdeckte genetische Komplexität ergänzt. Vielmehr haben sich hier isolierte und doch stabile Populationen entwickelt, die trotz potenzieller Kontaktflächen nur begrenzten genetischen Austausch untereinander hatten. Die Ergebnisse bringen zudem neue Fragen auf, wie es zur Herausbildung dieser einzigartigen Nordafrika-Linie kam und in welchem Ausmaß diese Populationen über den gesamten Kontinent verteilt waren. Sie liefern einen wichtigen Produktion von stammesgeschichtlichen Informationen, die bei der Interpretation alter menschlicher Migrationen sowie der Wege der Neolithisierung in Afrika und angrenzenden Regionen berücksichtigt werden müssen.
Darüber hinaus unterstreicht die Studie die Bedeutung interdisziplinärer Ansätze, die archäologische, paläoklimatische und genetische Daten verknüpfen, um das komplexe Bild der menschlichen Vergangenheit zu rekonstruieren. Angesichts des weltweiten Interesses an der menschlichen Evolution und der migrationshistorischen Entwicklungen ist die Entschlüsselung der genomischen Vergangenheit Nordafrikas von großer Bedeutung. Die Region wird oft in genetischen Studien vernachlässigt, da archäologisch-und genetisch relevante Proben und Daten bislang selten waren. Die neuen Daten aus Takarkori und Taforalt stellen daher eine überzeugende Erweiterung unseres Wissens dar und können künftig als Referenz für weitere Forschungen genutzt werden. Diese Forschung leistet darüber hinaus einen Beitrag zum globalen Verständnis, wie Umweltveränderungen, wie sie während der Grünen Sahara-Periode auftraten, die menschlichen Gesellschaften beeinflussten.