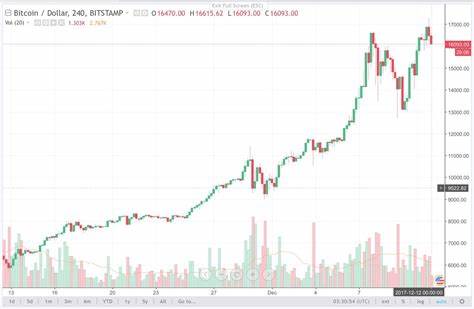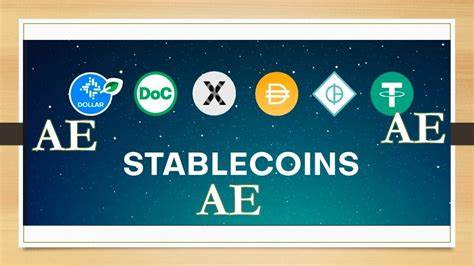In einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Spannungen und politischer Debatten wird die Rolle von Hochschullehrenden immer wieder infrage gestellt. Besonders deutlich wird dies an den Universitäten, wo sich wissenschaftliche Arbeit mit gesellschaftlichen Herausforderungen vermischt und zuweilen verhärtete Fronten entstehen. Dr. Boaz Barak, Professor für Informatik an der Harvard University, hat mit seinem Essay „I Teach Computer Science, and That Is All“ eine wichtige Diskussion angestoßen, die auch für deutsche Hochschulen und Lehrende im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) relevant ist. Dabei geht es um die Bedeutung von Professionalität, die Notwendigkeit klarer Grenzen zwischen akademischer Lehre und politischem Aktivismus sowie den Schutz des Vertrauens in die Hochschulbildung.
Sein Beispiel bietet Anlass für intensives Nachdenken über die Rolle von Professoren an Universitäten und die Gestaltung eines Lernumfelds, das dem wissenschaftlichen Fortschritt auf Dauer dient. Boaz Barak berichtete in seinem Essay, wie er angesichts politischer Konflikte auf dem Campus keine politischen Diskussionen oder Debatten in seine Informatikvorlesung einfließen ließ. Obwohl er sich persönlich engagierte – als israelisch-amerikanischer Professor und aktives Mitglied von Initiativen gegen Antisemitismus, unter anderem bei einer Mahnwache für Opfer terroristischer Anschläge –, trennte er seine politische Haltung strikt von seinem Beruf als Lehrender der Informatik. Diese Haltung ist nicht selbstverständlich, da besonders in der heutigen Zeit Hochschulen immer wieder zum Austragungsort gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen werden. Im Zentrum steht die klare Abgrenzung zwischen akademischer Lehre und politischem Engagement.
Barak weist darauf hin, dass viele Studierende seine Kurse besuchen, um die wissenschaftlichen Grundlagen und die technischen Fähigkeiten zu erlernen, die ihren späteren Berufsweg prägen sollen. In diesen Kontext politische Debatten einzubringen, könnte nicht nur den Lernprozess stören, sondern auch Studierende, die auf verschiedenen Seiten eines Campuskonflikts stehen, unnötig belasten. Er verdeutlicht, dass diese Trennung nicht bedeutet, gesellschaftliche Probleme zu ignorieren oder diese weniger wichtig zu nehmen. Vielmehr ist sie ein Ausdruck von Professionalität und Respekt gegenüber den Studierenden und der akademischen Mission. In einer Welt, in der gesellschaftliche Herausforderungen wie Antisemitismus, Klimawandel oder soziale Ungleichheit immer dringlicher werden, fordert eine solche Haltung Disziplin, Klarsicht und Verantwortungsbewusstsein.
Die Diskussion von Barak berührt auch einen fundamentalen Vertrauensverlust, der zuletzt in der Gesellschaft gegenüber Hochschulen und Wissenschaftlern beobachtet wurde. Umfragen zeigen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in akademische Institutionen – unabhängig von politischen Präferenzen – teils dramatisch eingebrochen ist. Dies birgt Gefahren nicht nur für die Hochschulen selbst, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt, denn Hochschulen sind als Wissenszentren essentielle Pfeiler von Fortschritt, Innovation und faktenbasierter Politikgestaltung. Wenn sich die Grenze zwischen Lehre und Aktivismus auflöst, kann dies eine Polarisierung fördern und Vorwürfe von Parteilichkeit oder Indoktrination hervorrufen, die das Ansehen der Hochschulen mindern. Das Credo von „I teach computer science, and that is all“ verweist auf eine behutsame Rückbesinnung auf das klassische Selbstverständnis des akademischen Lehrers.
Ein solcher Lehrer vermittelt fundiertes Wissen, fördert kritisches Denken und bereitet die Studierenden auf Herausforderungen in ihrer Fachwelt und darüber hinaus vor – ohne die akademischen Räume dabei als Bühne für politische Auseinandersetzungen zu nutzen. Gerade im Fachbereich der Informatik, wo komplexe theoretische Gedankengebäude auf praktische Anwendungen treffen, ist eine neutrale und fokussierte Lehrumgebung ein entscheidender Erfolgsfaktor. Trotzdem bedeutet diese Haltung nicht, dass Lehrende gesellschaftliche Themen ausklammern müssen. Sie können und sollten sich engagieren, etwa in der öffentlichen Debatte, Forschung oder im Rahmen universitätsinterner Initiativen. Doch im Seminarraum oder während der Vorlesung ist eine strikte Trennung von Lehrinhalten und politischen Statements für Barak unabdingbar.
Denn nur so kann gewährleistet werden, dass jeder Studierende unabhängig von seiner Herkunft, seinem Glauben oder seinen politischen Überzeugungen gleichberechtigt und ohne Beeinflussung lernt. Barak reflektiert auch kritisch über den Trend des sogenannten „Bringing your whole self to work“. Während dieser Ansatz die Inklusion, Authentizität und das Zugehörigkeitsgefühl in der Arbeitswelt fördern kann, birgt er die Gefahr, dass persönliche Überzeugungen und Emotionen zu sehr ins Berufsleben eindringen. Im akademischen Kontext kann dies die Objektivität und Professionalität beeinträchtigen. Die Herausforderung liegt darin, eine Balance zwischen individueller Selbstentfaltung und der Verpflichtung auf Wissenschaftlichkeit und Bildungserfolg zu finden, die letztlich allen zu Gute kommt.
Die Debatte hat auch eine besondere Relevanz im Kontext aktueller gesellschaftlicher Spannungen und internationaler Konflikte. Hochschulen, besonders in globalen Metropolen und renommierten Forschungsuniversitäten, sind multikulturelle Orte mit enormer Diversität. Konflikte, die sich dort spiegeln, können die Gemeinschaft zersetzen, wenn sie ungefiltert und unreflektiert in die Lehre einfließen. Ein Lehrender trägt deshalb auch Verantwortung als Vermittler von Respekt, Toleranz und Sachlichkeit – Qualitäten, die wesentlich für Wissenschaft und gesellschaftlichen Frieden sind. Neben dem Schutz der Lehrinhalte ist auch die Bewahrung der Rechte der Studierenden ein wichtiges Anliegen.
Barak verweist auf Anfragen von Studierenden, die um Nachsicht bei Abgabeterminen baten, aufgrund ihres Engagements in verschiedenen politischen Gruppierungen. Das konsequente Ablehnen solcher Nachgiebigkeiten im akademischen Kontext ist Ausdruck eines fairen und professionellen Umgangs mit allen Studenten, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung. Es verhindert die Entstehung von Privilegien und gleichzeitig die Gefahr, dass akademische Leistungen durch außerschulische Aktivitäten ungleich behandelt werden. Auf lange Sicht fordert diese Haltung eine bewusste Rückbesinnung auf die Kernaufgaben von Universität und Professoren. Forschung und Lehre müssen sich durch Wissenschaftlichkeit, Offenheit und Respekt gegenüber Vielfalt auszeichnen, ohne dadurch in Machtkämpfe oder ideologische Grabenkämpfe verwickelt zu werden.
Nur so können Hochschulen als verlässliche Brücken zwischen Wissen, Gesellschaft und Zukunft fungieren. In einer Zeit, in der Themen wie Künstliche Intelligenz, Datenschutz, Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft eine zentrale Rolle spielen, steht die Informatiklehre vor großen Herausforderungen. Studierende brauchen neben technischem Know-how auch die Fähigkeit, kritisch und verantwortungsvoll mit Technologien umzugehen. Diese Kompetenzen entstehen jedoch nur in einem Umfeld, das frei von ideologischer Instrumentalisierung ist und stattdessen auf wissenschaftliche Integrität setzt. Die Lehren von Dr.
Boaz Barak geben auch deutschen Universitäten wertvolle Impulse. Der akademische Diskurs und die politische Diskussion müssen klar getrennt bleiben, um die Qualität der Lehre hochzuhalten und den Zusammenhalt an den Hochschulen zu stärken. Zugleich darf das gesellschaftliche Engagement von Lehrenden nicht unterschätzt oder tabuisiert werden. Es bedarf eines differenzierten Verständnisses, das sowohl das persönliche Engagement als auch die professionelle Neutralität respektiert. Fazit ist, dass der Satz „Ich unterrichte Informatik – und sonst nichts“ keine Absage an politische Themen oder gesellschaftliche Verantwortung ist, sondern eine klare Haltung zugunsten der Professionalität, der Wissenschaftlichkeit und des Respekts vor der Vielfalt der Studierenden.
Gerade angesichts wachsender gesellschaftlicher Konflikte und des Vertrauensverlusts in akademische Institutionen sind solche Grundsätze unverzichtbar für die Zukunft der Hochschulbildung und der Gesellschaft insgesamt.