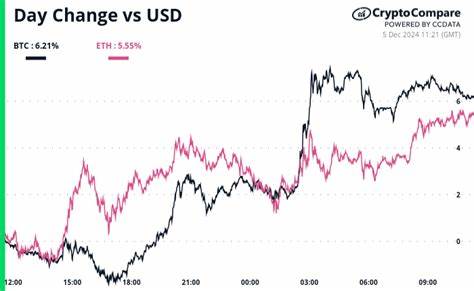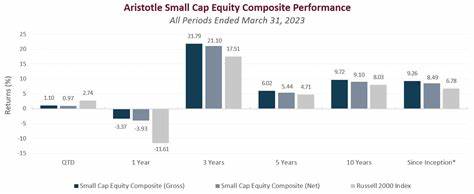Die weltweite Energiewende verlangt nach innovativen Lösungen, um erneuerbare Energien effizient speichern und bei Bedarf abrufen zu können. Insbesondere Technologien, die ohne großen Flächenverbrauch auskommen und eine hohe Speicherkapazität besitzen, gewinnen an Bedeutung. Eine faszinierende Entwicklung in diesem Bereich ist die Energiespeicherung im Ozean mithilfe riesiger, hohler Betonkugeln, die auf dem Meeresboden verankert werden. Dieses Konzept verspricht, eine nachhaltige, langlebige und vor allem umweltschonende Methode zu sein, die den Herausforderungen der heutigen Energiespeicherung gerecht wird. Den Ursprung dieses innovativen Ansatzes bildet das StEnSea-Projekt, initiiert vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (Fraunhofer IEE).
Seit 2011 erforscht das Team, wie sich die enorme Wasserdruckkraft in großer Meerestiefe gezielt nutzen lässt, um Strom zwischenzuspeichern. Das Prinzip ist einfach, zugleich aber technisch anspruchsvoll: Hohlkugeln aus Beton, mit einem Durchmesser von rund neun Metern und einem Gewicht von etwa 400 Tonnen, werden an Tiefen zwischen 600 und 800 Metern versenkt. Dort herrscht ein wesentlich höherer Wasserdruck als an der Oberfläche, der zum Speichern von Energie genutzt wird. Die Kugeln dienen als Energiespeicher, indem sie über Ventile Wasser einlassen oder herauspumpen. Ist eine Kugel vollständig entleert, entspricht das dem „voll aufgeladenen“ Zustand, denn das Innere liegt dann unter Vakuum und nimmt keinen Wasserdruck von außen auf.
Um Energie zu gewinnen, wird ein Ventil geöffnet und Wasser strömt mit hohem Druck in die Kugel. Dieser Wasserschwall treibt eine Turbine an, die elektrische Energie erzeugt und ins Stromnetz einspeist. Zum Wiederaufladen kommt elektrischer Strom aus dem Netz zum Einsatz, um das Wasser gegen den hohen Druck wieder aus der Kugel herauszupumpen. So kann der Kreislauf von Laden und Entladen immer wieder durchlaufen werden – ein cleverer Energiespeicher, der tief unter der Meeresoberfläche liegt. Diese Form der Speicherung ist eine neuartige Weiterentwicklung klassischer Pumpspeicherwerke.
Während letztere in der Regel zwei See- oder Behälterbecken in unterschiedlichen Höhenlagen benötigen und daher oft riesige Landflächen beanspruchen, spart das StEnSea-Konzept Gelände ein. Das ist gerade in dicht besiedelten oder umweltsensiblen Regionen von großer Bedeutung, wo Flächenknappheit oder Landschaftsschutz ein großes Problem darstellen. Zudem vereint die Unterwasserlagerung eine hohe Energiedichte mit kaum beeinträchtigenden Umwelteffekten. Die Technik der Betonkugeln ist dabei besonders interessant. Beton ist ein langlebiger und widerstandsfähiger Werkstoff, der den enormen Drücken auf 600 bis 800 Metern Tiefe über Jahrzehnte standhalten kann.
Die Fraunhofer-Forscher schätzen eine Lebensdauer von 50 bis 60 Jahren pro Kugel, was die Wirtschaftlichkeit des Systems unterstützt. Im Hinblick auf die Dimensionierung sind bereits kleinere Prototypen getestet worden. Ein Beispiel ist eine zehn Fuß (ca. drei Meter) große Kugel, die erfolgreich im Bodensee versenkt wurde. Für Ende 2026 ist der Einsatz einer maßstabsgetreuen, fast drei Meter größeren Kugel im Meer vor der Küste von Long Beach, Kalifornien, geplant.
Diese soll eine Leistung von 0,5 Megawatt erzeugen und Stromspeicherkapazitäten in Höhe von 0,4 Megawattstunden bieten – genug, um einen durchschnittlichen US-Haushalt etwa zwei Wochen lang zu versorgen. Eine der großen Chancen des Systems liegt in der Skalierbarkeit. Geplant sind zukünftig deutlich größere Kugeln mit einem Durchmesser von bis zu 30 Metern, die enorme Energiemengen speichern können. Fraunhofer gibt eine beeindruckende globale Speicherkapazität von 817.000 Gigawattstunden an.
Diese Menge könnte alle Haushalte in Deutschland, Frankreich und Großbritannien für ein ganzes Jahr mit Energie versorgen – eine Vorstellung, die das enorme Potenzial des StEnSea-Konzepts verdeutlicht. Kostenmäßig erscheint das Betonkugel-System wettbewerbsfähig. Die Speicherkosten werden bei etwa 5,1 Cent pro Kilowattstunde kalkuliert. Investitionskosten beziffert das Fraunhofer-Institut mit rund 177 US-Dollar pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Diese Zahlen basieren auf einem Referenzspeicher, der aus sechs Kugeln mit einer Gesamtleistung von 30 Megawatt und einer Kapazität von 120 Megawattstunden besteht.
Die langfristige Nutzung der Anlagen über fünf Jahrzehnte hinweg macht sie besonders attraktiv – gerade im Vergleich zu Batteriespeichern oder anderen Speichermethoden mit begrenzter Lebensdauer. Neben der ökonomischen Attraktivität bringt die Betonkugelspeicherung wichtige technische Vorteile mit sich. Die Lagerung im Meeresschien ist vergleichsweise wartungsarm und benötigt keine teuren Rohmaterialien wie seltene Metalle oder giftige Chemikalien. Außerdem lassen sich die Kugeln flächendeckend in Meeresregionen weltweit installieren, sodass das System potenziell global einsatzfähig wird. Für die Stabilisierung von Stromnetzen ist die Technologie hervorragend geeignet, vor allem was die Frequenzregelung oder die Bereitstellung von Reservekapazitäten betrifft.
Auch für den Stromhandel, bei dem Energie in Zeiten niedriger Preise gekauft und bei hohen Preisen verkauft wird (Arbitrage), bietet StEnSea interessante Möglichkeiten. Ein deutlicher Unterschied zu herkömmlichen Pumpspeicherkraftwerken liegt jedoch in der Effizienz und den Funktionsprinzipien. Pumpspeicheranlagen verbrauchen in der Regel weniger Energie im Speicherzyklus und sind heute gut ausgereift, benötigen allerdings geeignete geografische Bedingungen mit Höhenunterschieden. Das Bettungsvolumen der Betonkugeln hingegen kann weltweit vielfältig positioniert werden, was den Flächenbedarf auf das Meer verlagert, ohne dabei inhaberbegrenzte natürliche Ressourcen zu beanspruchen. Die Herausforderung besteht dabei, die Infrastruktur des Meeresbodens zu nutzen und zugleich Umwelteinflüsse wie Meeresströmungen, biologische Bewachsungen oder Sedimentablagerungen zu berücksichtigen.
Einige offene Fragen stellen sich für die Zukunft des Systems noch. Zum einen muss die Langlebigkeit der Betonkugeln unter extremen Bedingungen über Jahrzehnte durch weitere Langzeittests bestätigt werden. Korrosion durch salziges Wasser, mechanische Belastungen durch Druckwechsel und Umwelteinflüsse werden derzeit intensiv untersucht. Zudem ist die Wartung von Anlagen in 600 bis 800 Metern Tiefe anspruchsvoll und teuer. Daher wird nach Lösungen gesucht, die das System möglichst wartungsarm und robust machen, zum Beispiel durch geschlossene Systeme ohne direkten Wasserkontakt.
Die biologische Bewachsung der Einlassventile und die Vermeidung von Verstopfungen durch Sedimentablagerungen sind weitere technische Herausforderungen. Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich das Fraunhofer-Institut optimistisch hinsichtlich der Marktreife und der Anwendungsmöglichkeiten. Der US-Energieministerium hat bereits eine Förderung von vier Millionen US-Dollar für die Pilotphase genehmigt, um eine Demonstrationsanlage vor Kalifornien zu realisieren. Sollte sich das System bewähren, könnte es erheblich zur Netzstabilität beitragen und als Ergänzung zu Batteriespeichern und Pumpspeichern neue Wege in der Energiewelt eröffnen. Die Betonkugelspeicherung ist Teil einer wachsenden Gruppe von innovativen und manchmal ungewöhnlichen Technologien, die erneuerbare Energie zugänglicher und zuverlässiger machen möchten.
Sie kann als Teil eines zukünftigen Energiemixes eine Schlüsselrolle spielen, indem sie Flexibilität schafft und Überschussstrom speichert, der sonst verloren ginge. Zudem werden solche Technologien notwendig, wenn Wind- und Solarenergie weiter ausgebaut werden und zeitweise Windflauten oder Wolkenphasen überbrückt werden müssen. Insgesamt sind die gigantischen Betonkugeln, die am Meeresboden als Energiespeicher fungieren, ein überzeugendes Beispiel für disruptive Innovationen in der Energietechnik. Sie verbinden cleveres Ingenieurwesen mit natürlicher Ressourcennutzung, um eine nachhaltige Energiespeicherung zu realisieren, die nicht auf Landflächen angewiesen ist. Ihre Zukunft wird maßgeblich von weiteren praktischen Tests und dem Umgang mit technischen und ökologischen Herausforderungen abhängen.
Doch das Potenzial dieser Technologie ist groß – und könnte unsere Energieversorgung sicherer, grüner und effizienter machen.