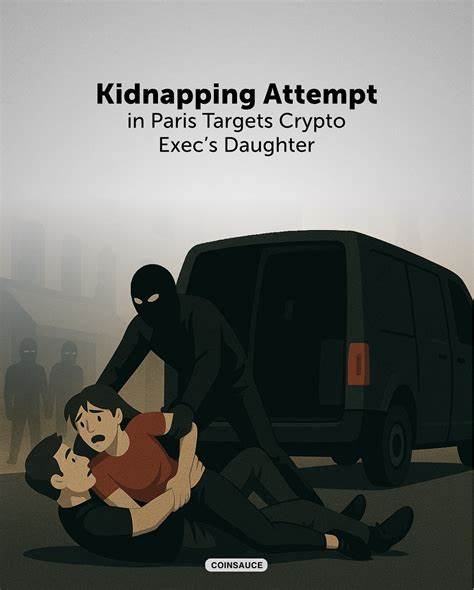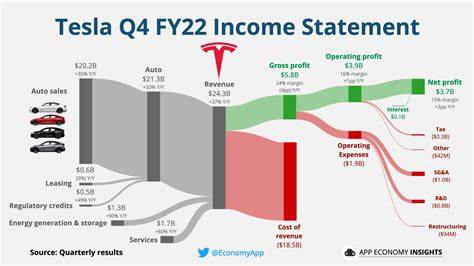Die Polarforschung, insbesondere während der sogenannten Heroischen Ära von etwa 1897 bis 1922, ist tief in der Vorstellung von männlichen Abenteurern verwurzelt. Namen wie Ernest Shackleton, Roald Amundsen oder Robert Peary dominieren die Geschichtsbücher und vermitteln das Bild einer Männerwelt, die die entlegensten und unwirtlichsten Gebiete der Erde eroberte. Was jedoch oft im Schatten dieser glorreichen Geschichten steht, sind die Herausforderungen, Vorurteile und Errungenschaften von Frauen, die sich trotz der rigiden gesellschaftlichen Einschränkungen ebenfalls dazu berufen fühlten, diese eisigen Regionen zu erkunden. Ihre Geschichte ist ebenso faszinierend wie inspirierend und offenbart viel über Geschlechterrollen, gesellschaftliche Normen und die Widerstandskraft menschlicher Entdeckerlust.Schon zu Beginn des 19.
Jahrhunderts wagte sich Isobel Gunn in die raue Wildnis des Nordens vor – allerdings verkleidet als Mann. Unter dem Namen John Fubbister arbeitete sie für die Hudson’s Bay Company und bewies nicht nur Mut, sondern auch eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit in einer Zeit, in der Frauen offiziell von solchen Expeditionen ausgeschlossen waren. Ihre wahre Identität wurde erst bekannt, als sie krank wurde und Hilfe suchte. Diese Geschichte verdeutlicht beispielhaft die Restriktionen, denen Frauen gegenüberstanden, und wie diese dennoch Wege fanden, ihre Sehnsucht nach Abenteuer zu erfüllen. Dass Isobel Gunn sich in einer Männerrolle versteckte, war nicht nur eine Notwendigkeit, sondern ein Statement gegen die vorherrschenden gesellschaftlichen Vorstellungen, die weibliche Eignung für solche Strapazen grundsätzlich in Frage stellten.
Die Heroische Ära der Polarforschung war geprägt von großen Expeditionen, die aus Geldmangel, geschlechtlichen Vorurteilen und sozialen Schranken häufig ausschließlich männliche Teams rekrutierten. Viele Frauen wurden systematisch ausgeschlossen, obwohl sie gleichermaßen den Wunsch hatten, die Grenzen des Bekannten zu verschieben. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür sind die drei Frauen, die Ernest Shackleton eine verwegene Bewerbung schickten, um ihn auf einer seiner Expeditionen zu begleiten. Trotz ihres Versprechens physischer Stärke und der Bereitschaft, männliche Kleidung zu tragen, wurden sie nicht berücksichtigt. Shackleton und andere Führer jener Zeit sahen in der Abwesenheit der Frauen einen Anreiz für Männer, ihre „Würdig“keit unter Beweis zu stellen.
Die Angst, dass Frauen die männliche Leistung in Frage stellen könnten, war größer als das Verlangen nach Gleichberechtigung im Feld der Entdeckung.Doch der Ausschluss von Frauen durch offizielle Expeditionen bedeutete keineswegs, dass Frauen sich nicht anderweitig an der Polarforschung beteiligten. Besonders in den arktischen Regionen lebten und leben Frauen schon seit Jahrtausenden als Teil indigener Gemeinschaften. Ihre Rolle wurde und wird oft unterschätzt, doch sie waren und sind wesentliche Bestandteile der Ökosysteme und der sozialen Strukturen dieser Gebiete. Die Bruchlinien zwischen «zivilisatorischen» und indigenen Lebensweisen zeigten sich auch in der Arbeit der Hudson’s Bay Company.
Während weiße Frauen offiziell von der Beschäftigung in nördlichen Außenposten ausgeschlossen waren, erlaubte man indigene Frauen, als Köchinnen und Dienstbotinnen zu arbeiten. Dieses Selektionskriterium auf Grundlage von Hautfarbe und Geschlecht illustriert die multiple Diskriminierung, der viele Frauen ausgesetzt waren.Eine bemerkenswerte Figur dieser Zeit ist Ada Blackjack, eine Iñupiat-Frau, die 1921 als Näherin an einer Expedition auf Wrangel Island teilnahm. Sie erlebte eine dramatische Geschichte als einzige Überlebende, nachdem ihr Team in der eisigen Wildnis zurückgelassen wurde und sie mehr als zwei Jahre im hohen Norden ausharren musste – davon beinahe acht Monate völlig allein. Ada Blackjacks Geschichte ist nicht nur eine Erzählung von unglaublicher Ausdauer und Überlebenswillen, sondern auch ein stilles Zeugnis dafür, dass Frauen nicht nur Begleiterinnen waren, sondern aktiv und essenziell bei extremen polaren Herausforderungen mithalfen.
Nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Frauen aus höheren Gesellschaftsschichten versuchten ihren Weg in die Antarktis zu finden. Die norwegische Ingrid Christensen begleitete 1931 zahlreiche Expeditionen und gilt gemeinsam mit ihrer Begleiterin Mathilde Wegger als eine Pionierin, die als erste Frauen überhaupt die antarktische Küste zu Gesicht bekamen. Einige Jahre später folgte Caroline Mikkelsen, die erste Frau, die tatsächlich „Fuß auf den Kontinent“ setzte. Diese Frauen waren jedoch vielfach nur als Ehefrauen oder persönliche Begleiterinnen der Expeditionsteilnehmer zugelassen, was ihnen damals eine Art indirekten Zugang ermöglichte. Dennoch änderte dies wesentlich an der strukturellen Ungleichheit nichts, die Frauen aus Expeditionen grundsätzlich ausschloss.
Wenn man die Rolle von Frauen in der Geschichte der Polarforschung betrachtet, fällt auf, dass ihr Potenzial weit stärker war, als lange narrative Strukturen dies zugelassen haben. Die Anerkennung der Leistungen und Geschichten weiblicher Forscherinnen und Teilnehmerinnen ist ein wichtiger Schritt zur Neubewertung der Heldengeschichten polarer Abenteuer. Die Paradigmen, die lange Geschlechterstereotype reproduziert und Frauen an den Rand gedrängt haben, werden zunehmend hinterfragt – auch durch die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Autorinnen wie Judith Niemi, Jesse Blackadder oder Victoria Rosner. Diese Forscherinnen lenken die Aufmerksamkeit auf den Einfluss von Geschlecht und Rasse auf den Zugang zu polaren Forschungsgebieten und zeigen, wie Geschichten von Frauen vielfach aus dem historischen Gedächtnis gelöscht oder ignoriert wurden.Der immer noch bürgerlich geprägte und männlich dominierte Charakter der polaren Forschung hat sich zwar verändert, doch auch heute kämpfen Frauen noch mit strukturellen Barrieren.
Das 20. Jahrhundert brachte eine allmähliche Veränderung, doch das Bild des forschen, einsamen männlichen Abenteurers sitzt tief. Die Geschichten von Frauen wie Ada Blackjack oder Ingrid Christensen fordern uns heraus, die schwarz-weißen Heldengestalten zu hinterfragen und die weißen Flecken in der Erzählung der Polarforschung zu füllen.Dabei wirft die historische Perspektive auch ein Licht auf die internationalen politischen Strategien rund um die Antarktis. Lange bevor Frauen formal Zugang zu den Forschungsreisen erhielten, nutzten Länder wie Argentinien und Chile die Geburt von Kindern durch dort geflogene schwangere Frauen als symbolische Geburtsorte nationaler Präsenz und territorialer Ansprüche.
Diese Praxis zeigt, wie Frauen ihre Körper auch als Politikinstrumente in der Geschichte der Polarforschung dienten – jedoch nur über Umwege und oft unfreiwillig. Die Begeisterung von Frauen für die Erforschung und Entdeckung der Polarregionen blieb stets lebendig, trotz der vielfältigen Hindernisse. Ihre Geschichten zeigen eine innere Stärke und das Verlangen nach Abenteuer, die sie über gesellschaftliche Normen und restriktive Gesetze hinaustragen. Frauen wollten und wollen sich nicht länger als bloße Begleiterinnen oder Randfiguren verstehen lassen, sondern als gleichberechtigte Teilnehmerinnen einer der faszinierendsten und brutalsten Erkundungen unserer Welt.Die moderne Polarforschung profitiert heute von dieser Pionierleistung und dem Durchhaltewillen zahlreicher Frauen, deren Beiträge lange Zeit verschwiegen oder vergessen wurden.
Ihre Geschichten motivieren neue Generationen, Grenzen zu überwinden – sei es sozial, kulturell oder geografisch. Das Zeitalter der Polarforschung ist somit nicht nur eine Geschichte der Eroberung von Eis und Schnee, sondern auch eine der Befreiung von Geschlechterrollen und der schrittweisen Anerkennung der Vielfalt menschlichen Forschergeistes an den entlegensten Orten der Erde.