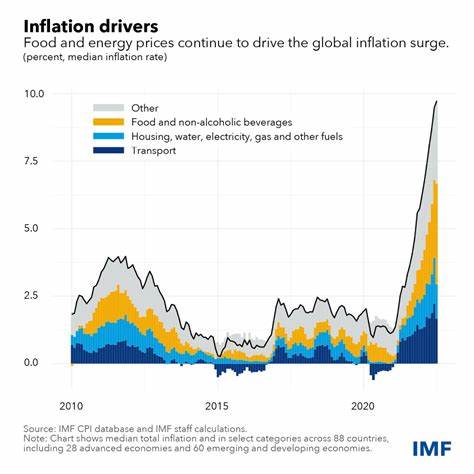Die fortschreitende Digitalisierung und der technologische Wandel haben viele Branchen tiefgreifend verändert, insbesondere die Unterhaltungsindustrie. In jüngster Zeit stehen Künstliche Intelligenz (KI) und deren Anwendung bei der Erstellung von Bildern, Videos und anderen kreativen Inhalten im Mittelpunkt intensiver Diskussionen – sowohl hinsichtlich ihrer Chancen als auch Risiken. Ein aktueller Fall, der hohe Wellen schlägt, ist die Klage von Disney und Universal gegen das auf die KI-Bildgenerierung spezialisierte Unternehmen Midjourney. Die beiden Hollywood-Giganten werfen Midjourney vor, durch die Nutzung ihrer bekannten Charaktere Urheberrechte zu verletzen. Dieses Ereignis bringt wichtige Fragen über die rechtlichen und ethischen Grenzen von KI im kreativen Prozess auf den Tisch und beleuchtet die Spannungen zwischen Innovation und geistigem Eigentum in der heutigen Zeit.
Midjourney ist ein Startup mit Sitz in San Francisco, das mit seiner KI-basierten Bildgenerator-Software in kürzester Zeit eine große Aufmerksamkeit erlangt hat. Nutzer können über einfache Texteingaben, sogenannte Prompts, einzigartige Bilder generieren lassen. Das System nutzt dabei Mustererkennung und Millionen von Bilddaten, um neue Grafiken zu erstellen. Genau hier liegt laut Disney und Universal das Problem: Die KI erzeugt zahlreiche Bilder, die ihren urheberrechtlich geschützten Figuren wie Darth Vader aus „Star Wars“, Elsa aus „Frozen“ und den Minions aus „Ich – Einfach unverbesserlich“ erstaunlich ähnlich sehen. Für die Studios ist dies kein bloßer Zufall, sondern eine gezielte und systematische Kopie ihrer wertvollen geistigen Eigentumsrechte.
In der Klageschrift, die vor dem Bundesbezirksgericht in Los Angeles eingereicht wurde, argumentieren Disney und Universal, dass Midjourney mit seiner Software nicht nur Millionen von Dollar Umsatz generiert – 300 Millionen US-Dollar allein im letzten Jahr – sondern auch eine baldige Einführung eines Video-Services plant, der das Urheberrechtsproblem weiter verschärfen könnte. Nach Aussage von Horacio Gutierrez, dem Chief Legal Officer von Disney, könne KI zwar verantwortungsvoll als Mittel zur Förderung menschlicher Kreativität eingesetzt werden, doch „Piraterie bleibt Piraterie – egal ob von Menschen oder Maschinen“. Diese klare Position verdeutlicht den Ernst der Anschuldigungen und die Sorge der Studios um den Schutz ihrer Kulturgüter. Doch was genau liegt der rechtlichen Bewertung dieser Auseinandersetzung zugrunde? Im Zentrum steht die Frage, ob die von Midjourney erzeugten Bilder tatsächlich eine verbotene Kopie der geschützten Werke darstellen oder ob sie unter das Prinzip der sogenannten „Fair Use“ – eine gesetzlich verankerte Schranke im Urheberrecht, die eine eingeschränkte Nutzung fremder Werke erlaubt – fallen. Fachleute wie der Rechtsprofessor Shubha Ghosh von der Syracuse University sehen viele der KI-generierten Bilder als reine Nachahmungen, bei denen lediglich der Hintergrund oder die Szene variiert werde, ohne dass eine kreative oder transformative Leistung erkennbar sei.
Somit fehle die notwendige Schöpfungshöhe, die Voraussetzung für eine eigenständige künstlerische Arbeit ist. Auf der anderen Seite betont der Jurist Randy McCarthy von der US-Kanzlei Hall Estill, dass der Ausgang dieses Rechtsstreits keineswegs vorhersagbar sei. Die Komplexität ergibt sich auch daraus, dass Midjourney in seinen Nutzungsbedingungen bestimmte Freiheiten und Haftungsausschlüsse festlegt, die es zu prüfen gilt. Der Gerichtshof wird abwägen müssen, inwieweit der Einsatz von KI im kreativen Prozess die traditionellen Konzepte von Urheberrecht und geistigem Eigentum infrage stellt. Die Frage, inwiefern eine maschinelle Kreation tatsächlich als neues, eigenständiges Werk gelten kann, ist dabei ein zentrales Thema.
Die Entwicklung zeigt sich auch in einem größeren historischen Kontext, der die ambivalente Haltung der Film- und Unterhaltungsindustrie zu neuen Technologien deutlich macht. Erst vor zwei Jahren führten neue technologische Möglichkeiten zu Streiks von Schauspielern und Drehbuchautoren, die sich gegen eine aus ihrer Sicht unfaire Nutzung von KI-Tools und den Verlust von Arbeitsschutzrechten wandten. Gleichzeitig werden dieselben Technologien heute zunehmend aktiv eingesetzt, etwa zur Bearbeitung von Stimmen oder zur Verjüngung von Schauspielern in Filmen. Beispiele wie Emilia Perez und The Brutalist, zwei Oscar-nominierte Filme, die auf KI für Stimmveränderungen setzten, verdeutlichen, wie tief die Technologien bereits in den Produktionsprozess integriert sind. Für Midjourney und ähnliche Unternehmen geht es daher um weit mehr als einen Rechtsstreit.
Es geht um die Legitimität und Grenzen ihres Geschäftsmodells, das auf dem Training von KI mit einer Vielzahl an Daten basiert, die meist urheberrechtlich geschützt sind. Die Debatte berührt grundlegende Fragen zur Zukunft von Kreativität: Wie können Künstler und Unternehmen ihre Werke schützen, wenn Maschinen zunehmend darauf zurückgreifen und diese kombinieren? Und wie kann der kreative Prozess durch KI sinnvoll ergänzt werden, ohne dass Urheberrechte verletzt oder entwertet werden? Die Perspektiven sind nicht nur rechtlicher Natur. Kulturell geht es um den Erhalt von künstlerischen Errungenschaften, die Teil des öffentlichen Bewusstseins und der Identität geworden sind. Disney und Universal stehen exemplarisch für eine Industrie, die jahrzehntelang Geschichten, Figuren und Welten erschaffen hat, die Millionen von Menschen weltweit begeistern. Der Schutz dieser Schöpfungen ist für sie existenziell, nicht nur ökonomisch, sondern auch im Hinblick auf das Vertrauen der Konsumenten und Fans.
Midjourney bezeichnet sich selbst als unabhängiges Forschungslabor, das mit einem kleinen, selbstfinanzierten Team an der Spitze moderner KI-Technologie arbeitet. Das Unternehmen wird von David Holz geführt, einem erfahrenen Unternehmer, der zuvor Leap Motion gründete. Unterstützt wird Midjourney unter anderem von renommierten Beratern wie Nat Friedman, ehemaliger Chef von Github, und Philip Rosedale, dem Gründer von Second Life. Das zeigt, wie bedeutend und zukunftsträchtig diese Technologie angesehen wird. Während sich der Rechtsstreit entfaltet, wird die Unterhaltungsbranche weiter beobachtet werden, wie sie die Balance zwischen Innovation und Rechtsschutz gestaltet.
Die Gerichtsentscheidung in Los Angeles könnte wegweisend sein für die gesamte Branche sowie für den Umgang mit KI-generierten Inhalten weltweit. Es besteht die Hoffnung, dass ein fairer, ausgewogener Kompromiss gefunden wird, der kreative Freiheit und technologische Entwicklung fördert, ohne die Rechte von Künstlern und Unternehmen zu untergraben. In jedem Fall ist der Fall Disney und Universal gegen Midjourney ein deutliches Signal, dass künstliche Intelligenz nicht nur Chancen, sondern auch enorme Herausforderungen mit sich bringt. Die Debatte um Urheberrecht und KI wird wohl noch lange zu den prägenden Themen der digitalen Ära gehören. Für Studios und Kreative bleibt es daher unerlässlich, aktiv an der Gestaltung der neuen rechtlichen Rahmenbedingungen mitzuwirken, um ihre Werke zu schützen und gleichzeitig offen für innovative Technologien zu bleiben.
Die Zukunft der Kreativwirtschaft hängt entscheidend davon ab, wie dieser Spagat gemeistert wird.