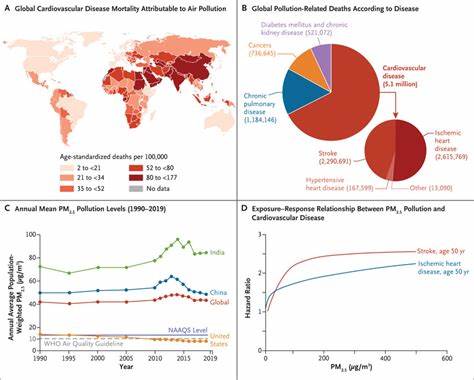Herzkrankheiten zählen seit Jahren zu den Hauptursachen für Krankheitslast und Todesfälle weltweit. Doch während traditionelle Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen und genetische Veranlagung intensiv erforscht wurden, rücken zunehmend Umweltfaktoren wie Schadstoffe in den Mittelpunkt medizinischer und gesundheitspolitischer Debatten. Besonders hervorzuheben sind hierbei Phthalate, chemische Verbindungen, die als Weichmacher in Kunststoffen verwendet werden und in zahlreichen Alltagsgegenständen vorkommen. Neue wissenschaftliche Analysen legen nahe, dass die tägliche Belastung mit Phthalaten in 2018 für mehr als 365.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Herzkrankheiten verantwortlich war.
Dies entspricht über 10 % der globalen Herz-Kreislauf-Todesfälle bei Menschen im Alter von 55 bis 64 Jahren. Phthalate kommen in einer Vielzahl von Produkten vor: von Lebensmittelbehältern, medizinischen Geräten, Kosmetika über Reinigungsmittel bis hin zu Kinderspielzeug und Verpackungsmaterialien. Ihre weitreichende Verwendung resultiert daraus, dass sie Kunststoffe weicher, flexibler und haltbarer machen. Insbesondere eine Phthalatart, die als Di-2-ethylhexylphthalat (DEHP) bekannt ist, steht im Fokus der Forschung, da sie in zahlreichen Produkten verwendet wird, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen oder im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Phthalaten sind vielfältig.
Frühere Studien haben Verbindungen zwischen ihnen und verschiedenen Leiden hergeleitet, darunter Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Hormonstörungen, Fertilitätsprobleme und sogar einige Krebsarten. Neuere Forschungsergebnisse fokussieren besonders auf kardiovaskuläre Erkrankungen. DEHP könne im menschlichen Körper eine Überreaktion des Immunsystems, insbesondere eine entzündliche Reaktion in den Arterien des Herzens, auslösen. Chronische Entzündungen dieser Art gelten als wichtige Auslöser für Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall. Eine umfangreiche Untersuchung, geleitet von Wissenschaftlern des NYU Langone Health, analysierte Daten aus zahlreichen Bevölkerungs- und Gesundheitsstudien weltweit.
Hierzu zählten Urinproben, in denen Abbauprodukte von DEHP nachgewiesen wurden, sowie Todesfallstatistiken aus dem Institute for Health Metrics and Evaluation. Die Kombination dieser Daten ermöglichte eine Schätzung der durch DEHP bedingten Herz-Todesfälle in 200 Ländern und Regionen. Die Ergebnisse unterstrichen auffällige regionale Unterschiede. Besonders betroffen waren Bevölkerungen in Afrika, Südostasien und dem Nahen Osten. Diese Regionen trugen etwa die Hälfte aller Herz-Todesfälle, die mit DEHP-Exposition zusammenhängen.
Indiens Zahlen waren dabei am dramatischsten, mit fast 40.000 Todesfällen, gefolgt von Pakistan und Ägypten. Ein entscheidender Faktor dürfte sein, dass diese Länder zwar eine rasante Industrialisierung und steigende Plastikproduktion erleben, jedoch oftmals ohne ausreichend strikte Umwelt- und Gesundheitsschutzregelungen. Das Ausmaß der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden, die den belastenden Chemikalien zugeschrieben werden, ist enorm. Die Studie schätzt die finanziellen Belastungen durch die mit DEHP verbundenen Herzerkrankungen auf rund 510 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018, wobei die Obergrenze sogar schätzungsweise 3,74 Billionen US-Dollar erreichen könnte.
Diese Zahlen umfassen direkte Gesundheitskosten, Produktivitätsverluste und weitere wirtschaftliche Folgen. Die Problematik von Phthalaten geht jedoch über den unmittelbaren Gesundheitsschaden hinaus. Die weitverbreitete Nutzung von Kunststoffprodukten, die diese Stoffe enthalten, führt zu einer beständigen, chronischen Exposition in nahezu allen Gesellschaften. Phthalate gelangen über verschiedene Wege in den Körper: beim Verzehr von verpackten Lebensmitteln, durch direkten Kontakt mit phthalathaltigen Produkten oder über die Luft und den Staub in belasteten Umgebungen. Die Forschung weist darauf hin, dass sich die Schadstoffbelastung nicht gleichmäßig verteilt.
Menschen in Entwicklungsländern und Regionen mit weniger Regulierung erleben häufig höhere Expositionsraten. Dies führt nicht nur zu einer erhöhten Krankheitslast, sondern verstärkt auch bestehende soziale und gesundheitliche Ungleichheiten. Besonders alarmierend ist, dass personengruppenbedingte Faktoren wie Alter, Beruf und soziale Schicht die individuelle Belastung beeinflussen können – ein Aspekt, der in zukünftigen Studien weiter untersucht werden muss. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass die bisherige Forschung sich überwiegend auf DEHP konzentriert hat, obwohl es eine Vielzahl weiterer Phthalatarten gibt, deren gesundheitliche Auswirkungen bislang nicht umfassend erfasst sind. Es ist daher wahrscheinlich, dass die tatsächliche Sterblichkeitsrate durch phthalatbedingte Herzkrankheiten noch höher ist als die aktuellen Schätzungen vermuten lassen.
Zudem waren die untersuchten Altersgruppen begrenzt, und andere kardiovaskuläre Erkrankungen oder Begleiterkrankungen wurden nicht vollständig berücksichtigt. Neben der Sterblichkeit zeigen sich auch andere negative gesundheitliche Folgen, die mit Phthalatbelastung einhergehen. Die Wissenschaftler planen daher, zukünftig weitere Gesundheitsaspekte, wie etwa Frühgeburten oder hormonelle Störungen, detailliert zu erforschen und deren Zusammenhang mit den Chemikalien zu quantifizieren. Die dringende Forderung der Forscher und Fachleute lautet, die Exposition gegenüber Phthalaten global zu reduzieren. Dies erfordert nicht nur schärfere gesetzliche Vorgaben und Überwachungsmaßnahmen, sondern auch ein Umdenken bei Herstellern, Verbrauchern und politischen Entscheidungsträgern.
Insbesondere für Länder mit rasantem Industriewachstum sollten sichere Produktionsverfahren und verbesserte Verbraucherschutzmaßnahmen Priorität haben. Auch individuelle Schutzmaßnahmen können helfen, die Belastung zu minimieren. Verbraucher könnten durch bewusste Kaufentscheidungen phthalatfreie Produkte wählen, frische statt verpackte Lebensmittel bevorzugen und den Einsatz von Kunststoffen im Alltag reduzieren. Darüber hinaus könnte die Wissenschaft neue, sichere Alternativen zu Phthalaten entwickeln und deren Einsatz fördern. Das Thema Phthalate und Herzgesundheit zeigt exemplarisch, wie Umweltfaktoren und menschliches Verhalten direkte Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben können.