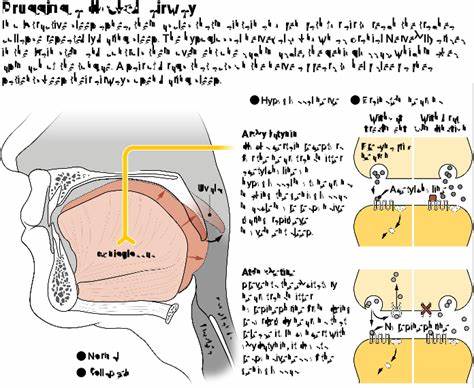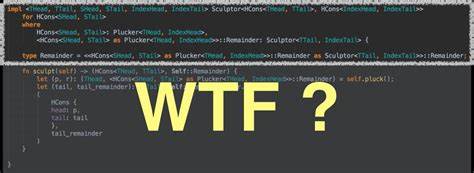Die Dominanz der US-amerikanischen Cloud-Giganten Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud auf dem europäischen Markt stellt eine der größten Herausforderungen für die digitale Souveränität Europas dar. Trotz der weit verbreiteten Diskussionen und politischen Bestrebungen, die Abhängigkeit von US-Hyperscalern zu reduzieren, zeigen aktuelle Analysen und Branchenmeinungen, dass eine vollständige Loslösung nahezu unmöglich ist. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von mangelnder Datacenter-Kapazität über technologische Abhängigkeiten bis hin zu wirtschaftlichen Zwängen und einem fehlenden europäischen Konkurrenzangebot. Einer der zentralen Punkte ist die enorm begrenzte Datacenter-Kapazität auf europäischem Gebiet. Laut Experten würde es bei den bisherigen Baugeschwindigkeiten etwa 20 Jahre dauern, um genügend Cloud-Kapazitäten auf dem Kontinent aufzubauen, um die aktuelle Nachfrage zu decken – und das ohne zukünftige technologische Anforderungen, wie beispielsweise die durch künstliche Intelligenz oder generative KI entstehenden Mehrbedarfe zu berücksichtigen.
Die Hyperscaler aus den USA können dank ihrer jahrzehntelangen Entwicklung und massiven Investitionen auf ein weit verzweigtes Netzwerk von Rechenzentren zurückgreifen, das eine schnelle Skalierung und hohe Verfügbarkeit garantiert. Darüber hinaus sind viele europäische Fachkräfte auf die Nutzung der Plattformen der großen US-Anbieter spezialisiert. Sie verstehen die Cloud-Architekturen und optimieren Systeme auf deren Infrastruktur. Ein Umstieg auf ein lokales oder europäisches Cloud-Ökosystem würde bedeuten, dass diese erfahrenen Spezialisten neue Plattformen quasi von Grund auf erlernen müssten – ein Szenario, das im Arbeitsalltag und der Unternehmensstrategie auf wenig Gegenliebe stößt, da es zeit- und kostenintensiv ist und kurzfristig zu Leistungseinbußen führen könnte. Neben den technischen Hürden zählt auch die Frage der Lieferketten und Marktstrukturen zu den wesentlichen Herausforderungen.
Viele europäische Cloud-Anbieter sind nicht nur hinsichtlich ihres Angebots beschränkt, sondern greifen für bestimmte Dienste selbst auf Infrastruktur und Technologien der US-Hyperscaler zurück. Dies schafft eine indirekte Abhängigkeit, auch wenn Kunden formal gesehen mit einheimischen Dienstleistern zusammenarbeiten. Das Ökosystem der amerikanischen Anbieter ist derart umfassend, dass neben reiner Rechenleistung auch zahlreiche Zusatzleistungen und Plattformdienste angeboten werden, die von Sicherheitsfunktionen über KI-Services bis hin zu globalen Netzwerken reichen und auf europäischem Terrain nur schwer replizierbar sind. Die seit einigen Jahren zunehmenden geopolitischen Spannungen, vor allem unter dem Einfluss der US-amerikanischen Innenpolitik der vergangenen Jahre, haben das Bewusstsein für digitale Souveränität zwar geschärft. Insbesondere die Trump-Administration führte in Europa zu einem erhöhten Risikobewusstsein, denn es wurde deutlich, dass geopolitische Entscheidungen in Washington auch direkte Auswirkungen auf europäische Unternehmen und ihre IT-Sicherheit haben können.
Dennoch ist der schnelle Ausstieg aus der Abhängigkeit von US-Anbietern keine realistische Option – die Migration von Workloads, Daten und Anwendungen ist extrem komplex und teuer. Zudem haben viele Firmen in den vergangenen Jahren interne IT-Kompetenzen aus Kostengründen abgebaut, was die Rückkehr zu eigenen Rechenzentrumslösungen zusätzlich erschwert. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verfestigen die Situation weiter. Eine weitere Herausforderung ist die sogenannte „Vendor Lock-in“-Problematik, bei der Kunden bei der Wahl des Hyperscalers durch vertragliche Bindungen und finanzielle Wechselkosten stark eingeschränkt sind. Speziell Exit-Kosten wie hohe Daten-Egress-Gebühren können von den Cloud-Anbietern verhängt werden, was den Wechsel zu einem anderen Anbieter oder zurück auf lokale Lösungen erschwert und Unterfangen zur Datenrückführung praktisch blockiert.
Parallel zu diesen Herausforderungen entwickelt die Europäische Kommission Strategien zur digitalen Souveränität, allerdings sind die Erwartungen gemäß einem nun öffentlich gewordenen Entwurf eines International Digital Strategy-Papiers von Ende Mai 2025 realistisch eher gedämpft. Demnach sei eine vollständige Abkopplung von den großen US-amerikanischen Cloud-Anbietern unrealistisch, und eine zukünftige Zusammenarbeit bleibe unabdingbar, insbesondere entlang der gesamten technologischen Wertschöpfungskette. Trotz aller Widrigkeiten steigt das Interesse an europäischen oder zumindest souveränen Cloud-Angeboten, denn viele Unternehmen und öffentliche Institutionen suchen nach Möglichkeiten, ihre Datenhoheit zu erhöhen und ihre IT-Strukturen unabhängiger von externen Einflüssen zu gestalten. Allerdings bieten regionale und lokale Cloud-Provider bislang zumeist nur eingeschränkte Dienste an und verfügen weder über die Skalierung noch die Vielfalt der Services der US-Hyperscaler. Aus diesem Grund sind hybride oder Multi-Cloud-Strategien entstanden, bei denen Unternehmen verschiedene Anbieter kombinieren, um die Risiken einer vollständigen Abhängigkeit von einem einzigen Player zu verringern.
Die Expertise europäischer Anbieter und Dienstleister wächst zwar kontinuierlich, doch sie stehen vor dem Problem zu spät in den Markt eingestiegen zu sein. Als die Cloud-Technologie und Marktstrukturen in den 2010er Jahren rasant wuchsen, hatte Europa entweder andere Prioritäten oder konnte wegen fehlender Innovationskraft nicht aufholen. Die intensive Investition und Entwicklungskapazität der US-Konzerne haben eine Marktsituation geschaffen, die für Newcomer extrem schwer zu durchbrechen ist. Vor allem auch die Anforderungen global agierender Unternehmen erschweren die Situation. Viele der multinationalen Konzerne mit Sitz in Europa benötigen eine globale Präsenz der Cloud-Provider, die alle ihre Standorte effizient bedienen können.
US-Hyperscaler bieten dieses breite Netz von Rechenzentren mit entsprechender Infrastruktur an, inklusive Compliance mit lokalen Datenschutzgesetzen, was europäische Cloud-Anbieter in diesem Umfang nur ansatzweise abbilden können. Trotz der dominierenden Stellung der amerikanischen Anbieter gibt es aber auch Anzeichen für einen Wandel. Einige US-Konzerne haben begonnen, gezielt Rechenzentren und Dienste in europäischen Ländern auszubauen, um Anforderungen an Datenhoheit und Datenschutz entgegenzukommen. Microsoft beispielsweise hat signalisiert, verstärkt europäische Infrastruktur und digitale Lösungen anzubieten, die lokale Compliance und regulatorische Bedürfnisse stärker berücksichtigen. Die Zukunft der Cloud-Landschaft in Europa wird somit durch einen komplexen Mix aus geopolitischen, wirtschaftlichen, technischen und regulatorischen Faktoren geprägt.
Eine vollständige Befreiung von US-Hyperscalern erscheint trotz großer Bestrebungen aktuell nahezu unmöglich, zumindest in absehbarer Zeit. Dennoch wächst der Druck auf Unternehmen und Regierungen, digitale Strategien zu entwickeln, die das Risiko der Abhängigkeit mindern und gleichzeitig technologischen Fortschritt und Wirtschaftlichkeit berücksichtigen. Innovationen im Bereich vertrauenswürdiger Cloud-Plattformen, Investitionen in Kompetenzentwicklung sowie verstärkte Kooperationen innerhalb Europas könnten langfristig zu einer stärkeren regionalen Cloud-Infrastruktur führen. Bis dahin wird die Kombination aus pragmatischem Umgang mit den US-Angeboten und schrittweisem Aufbau eigener Kapazitäten der Weg sein, auf dem sich die digitale Souveränität Europas weiterentwickelt. Die Herausforderung besteht darin, dass diese Entwicklung sowohl die Zeit als auch Ressourcen beansprucht, die viele Unternehmen heute nicht schnell aufbringen können.
So bleibt die Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud-Hyperscalern weiterhin ein zentrales Thema für Europas digitale Zukunft.





![Turning Portal 2 into a Web Server [video]](/images/97FA3ED9-CD61-4A54-9319-6F95CA02E0DB)