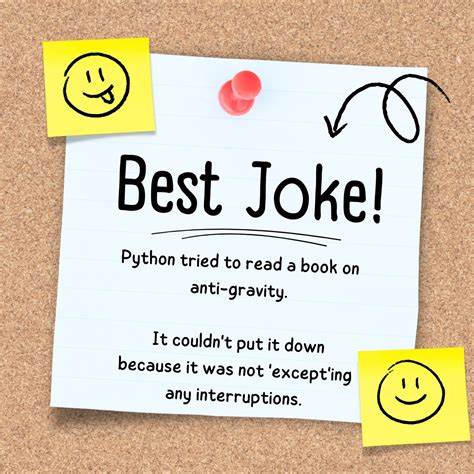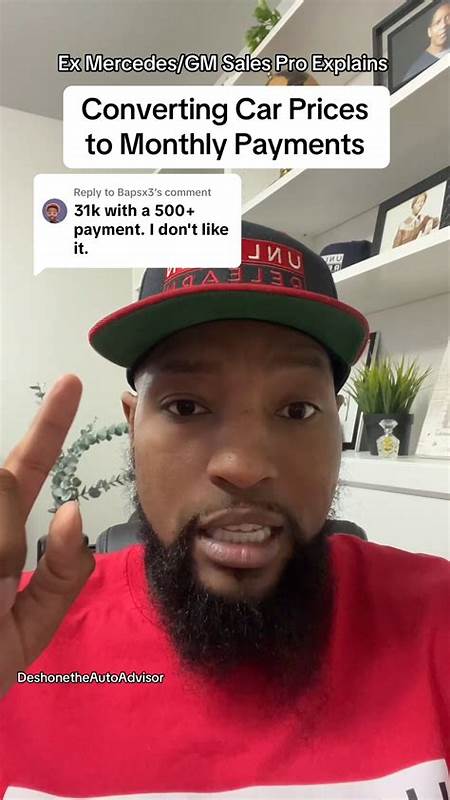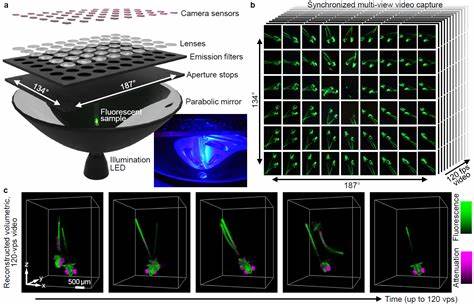Python ist seit vielen Jahren eine der beliebtesten Programmiersprachen weltweit. Ihre Einfachheit, Lesbarkeit und breite Einsatzmöglichkeiten machen sie zur ersten Wahl für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Entwickler. Doch genau diese Einfachheit kann auch in die Irre führen und zu wahrem Chaos im Code führen. Es mag paradox klingen, doch der bewusste Blick auf das Gegenteil der Best Practices – also auf den schlechtesten Python-Code, den man schreiben kann – hilft nicht nur, Fehler zu vermeiden, sondern regt auch auf humorvolle Art zum Nachdenken über sauberes Coding an. Beginnen wir mit einem essentiellen Fehler, der selbst erfahrene Entwickler immer wieder machen: kryptische und undurchschaubare Variablennamen.
Statt klar zu benennen, wofür eine Variable steht, sind Namen wie x, y oder z der Standard. Noch besser funktioniert es, wenn Sie sich gar nicht erst um Sinnhaftigkeit kümmern und Namen mehrfach mit unterschiedlichen Inhalten belegen. Das ist eine hervorragende Einladung für spätes Kopfzerbrechen und rätselhafte Fehlersuche, besonders wenn ein Notfall in der Produktion vorliegt. Die Pflege solcher Codezeilen ist eine Belastung für jeden einzelnen im Team. Weiter geht die Reise ins Chaos mit der ungezügelten Verwendung von Importanweisungen.
Warum sich auf einzelne Module fokussieren, wenn man auch gleich alles importieren und sich somit Namenskonflikte und unerwartete Schattenungen ins Haus holen kann? Kombinieren Sie dies mit dem wilden Streuen von Imports irgendwo im Code, anstatt sie am Anfang der Datei zu bündeln – so bietet das Programm eine echte Schatzsuche beim Debugging. Jede Fehlermeldung wird so zu einem spannenden Abenteuer. Ein weiterer Garant für schwierigen Code sind Funktionen, die alles und nichts gleichzeitig machen sollen. Ein einziger Monolith, der Benutzerdaten verarbeitet, E-Mails versendet, Datenbanken aktualisiert und Reports generiert, zeichnet sich durch immense Länge und undurchdringliche Logik aus. Hier gilt: Je umfangreicher und komplexer, desto besser! Der Zweck von Funktionen, nämlich klar umrissene Aufgaben zu erfüllen, wird dabei konsequent ignoriert, zugunsten von „funktionalem Overkill“.
Fehlerbehandlung darf keinesfalls konsequent und sorgfältig implementiert werden. Stattdessen ist das Ignorieren von Ausnahmen nämlich die wahre Kunst. Eine try-except-Konstruktion ohne jegliches Handhaben der Fehler, vielleicht mit einem lässigen pass im Except-Block, lässt Programme elegant durch Fehler hindurchsegeln, ohne dass jemand etwas merkt – bis zum großen Crash. Noch besser wirkt es, wenn Fehlermeldungen gerne mal mit humorvollen, nichtssagenden Kommentaren überdeckt werden und trotzdem der Vorgang als Erfolg deklariert wird. So vermittelt man den Eindruck, alles laufe wie am Schnürchen, auch wenn das Gegenteil der Fall ist.
Kommentare? Erklärungen? Davon sollte man sich fernhalten. Einzig wahre Meister des schlechten Codes lassen ihr Werk für sich sprechen – und bieten so jeder Person, die damit arbeitet, ein Rätsel der Extraklasse. Lange verschachtelte List-Comprehensions und komplexe Lambdas verstricken sich in Undurchsichtigkeit. Wer will schon Zeit mit detaillierten Hilfestellungen verschwenden, wenn Verwirrung viel spannender ist? Globale Variablen sind ebenfalls ein unverzichtbares Werkzeug für chaotischsten Code. Das gierige Heranziehen und Mutieren von Daten aus dem globalen Raum garantiert unvorhersehbare Seiteneffekte, die es nahezu unmöglich machen, den Programmfluss nachzuvollziehen.
So wird das Debuggen zur unendlichen Schatzsuche, bei der jeder Moment eine neue Überraschung bereithält. Bei der Verarbeitung von Strings und Datenformatierungen sollte man sich von zeitgemäßen und sicheren Techniken fernhalten. F-Strings oder .format() gelten hier als zu kompliziert und unnötig. Wer stattdessen mit purer Zeichenkettenverkettung arbeitet, lädt nicht nur potentielle SQL-Injection-Angriffe ein, sondern verpasst auch die Chance auf sauberen, übersichtlichen Code.
Performanceoptimierungen sind völlig überbewertet. Warum sich mit Indizes oder schnellen Algorithmen beschäftigen, wenn man auch einfach alle Datensätze bruteforce durchgehen kann? Nutzer lieben doch die Wartezeit, und der Server freut sich über die Schnelligkeitsübung. Nachvollziehbarkeit und Skalierbarkeit treten in den Hintergrund zugunsten von ineffizientem Spaß. Auch die Konfigurationsverwaltung kann man mit wenig Aufwand unübersichtlich gestalten. Hardcodierte Schlüssel, Passwörter und Verbindungsstrings, verteilt in beliebigen Dateien oder sogar mitten im Code, laden zu Verwirrung und Sicherheitsproblemen ein.
Änderungen der Einstellungen sind eine zerstreute Odyssee und garantieren, dass nie ganz sicher ist, welche Werte tatsächlich verwendet werden. DRY – also Don't Repeat Yourself – ist zwar ein guter Grundsatz, der aber kreativ umgangen werden kann. Copy-Paste ist die Antwort! Viele fast identische Funktionen mit kleinsten Unterschieden sorgen für doppelte, dreifache oder sogar vielfache Wartungsarbeit. Änderungen an einer Stelle zu vergessen oder nicht konsequent umzusetzen, bringt neuen Fehlernachschub und garantiert Job-Sicherheit für die Entwickler. Statt auf bewährte Bibliotheken zu vertrauen, wird jede Funktion am besten eigenhändig entwickelt – und zwar ohne auf Standardlösungen zurückzugreifen.
Eigene HTTP-Clients, CSV-Parser und JSON-Interpreter sind der Schlüssel zum zeitintensiven Vergnügen. Dabei werden allerdings wichtige Aspekte wie Sicherheit, Fehlerbehandlung oder Performance großzügig ignoriert. Denn wahre Programmierer wollen nicht einfach nur funktionierenden Code, sondern auch das Vergnügen, immer wieder auf bereits gelöste Probleme zu stoßen und sie aufwändig neu zu meistern. Professionelle Entwicklungsumgebungen braucht niemand. Wer sich nicht mit Autovervollständigung, Syntax-Highlighting oder Linting quälen will, schreibt am besten in einem simplen Editor wie Notepad.
Rechtschreibfehler, fehlende Codeformatierungen und unübersichtliche Syntax schaffen den authentischen Flair von echter Handarbeit. Bugs kommen so von ganz alleine zum Vorschein – oft erst in der Produktion. Und schließlich erweisen sich auch moderne Hilfsmittel wie KI-gestützte Programmierassistenten als überflüssig. Wer auf die automatische Generierung von Code, Optimierungsvorschläge oder Bugdetektion verzichtet, sammelt wertvolle Erfahrung mit manueller Tipperei, stundenlangem Googeln und leidenschaftlichem Entwickeln von eigenen, suboptimalen Lösungen. So bleibt das Gefühl des wahren Handwerks erhalten, während sämtliche zeitgemäße Komfortfunktionen außen vor bleiben.
Testen im klassischen Sinne wird dabei großzügig ignoriert. Provisorische Tests, die eigentlich gar keine sind, oder komplett fehlende automatisierte Tests sorgen für die echte Überraschung in der Live-Umgebung. Erst wenn Nutzer mit unerwarteten Eingaben das Programm zum Absturz bringen, erkennt man, wie robust der Code wirklich ist. All diese Methoden kombiniert führen zu einem magischen Elixier aus Chaos, Frustration und jeder Menge Arbeit für alle Beteiligten. Doch humorvoll ausgedrückt lässt sich daraus ein wichtiger Rat ableiten: Wer schlechten Python-Code absichtlich schreibt oder zumindest die Muster darin erkennt, lernt am besten, wie wichtig Klarheit, Struktur und bewährte Praktiken sind.
Im Endeffekt profitieren Entwickler, Teams und Projekte umso mehr, je mehr sie den gegenteiligen Weg wählen und bewährte Coding-Standards, aussagekräftige Benennungen und saubere Fehlerbehandlung einsetzen. Amüsieren Sie sich also über die Fallstricke schlechter Programmierung, aber nehmen Sie sie auch als Warnung mit auf Ihren eigenen Entwicklungsweg – dann schlafen Sie nachts besser und sparen eine Menge Zeit und Nerven. Humor spielt dabei eine Schlüsselrolle. Das bewusste Überzeichnen und Karikieren schlechter Codierpraktiken zeigt auf zugespitzte Weise, was man vermeiden sollte. Gleichzeitig bietet es Entwicklern die Gelegenheit, gemeinsam über Missgeschicke zu lachen und daraus zu lernen.
Wer sich auf den humorvollen Pfad begibt, wird feststellen, dass Humor im Softwareentwicklungsprozess nicht nur das Klima im Team verbessert, sondern auch die Kreativität fördert und wichtige Lernmomente verstärkt. Schlechter Code bringt schlussendlich niemanden weiter – außer als abschreckendes Beispiel. Doch mit einem zwinkernden Auge kann man daran wachsen und seine Fähigkeiten stetig verbessern.