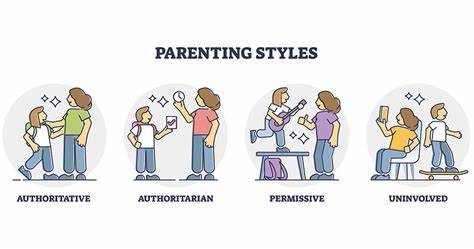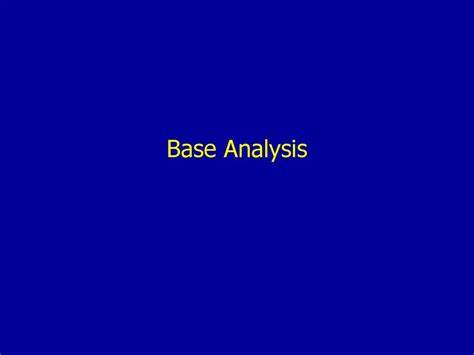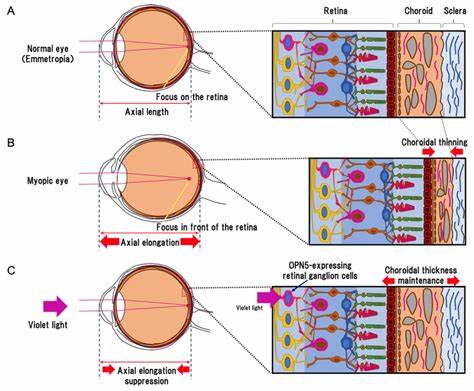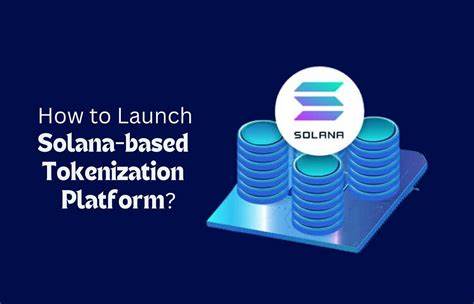Die Frage, ob Kinder besser versorgt sind, wenn nur ein Elternteil arbeitet oder wenn beide berufstätig sind, ist ein gesellschaftlich und familiär hoch relevanter Diskurs. In der modernen Arbeitswelt, die zunehmend von Dynamik, Vielfalt und neuen Rollenbildern geprägt ist, treffen unterschiedliche Meinungen aufeinander. Während einige Befürworter eines Elternteils zuhause die wichtige Familienpräsenz hervorheben, sehen andere in der doppelten Erwerbstätigkeit eine Chance für finanzielle Sicherheit und Vorbilder für Geschlechtergleichheit. Aktuelle Umfragen und Studien bieten wertvolle Einblicke, welche Haltungen vor allem Jugendliche, aber auch Erwachsene in den Vereinigten Staaten zu diesem Thema vertreten. Diese Erkenntnisse sind auch für den deutschsprachigen Raum interessant, da sich ähnliche soziale Debatten abzeichnen.
Eine repräsentative Studie des Pew Research Center aus dem Herbst 2024 befragte Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren in den USA zu ihren Ansichten darüber, wie sich die Arbeits- und Familienkonstellation der Eltern auf Kinder auswirkt. Erstaunlicherweise gaben 57 Prozent der befragten Jugendlichen an, dass Kinder genauso gut dran sind, wenn beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 43 Prozent hingegen vertreten die Meinung, dass es besser sei, wenn ein Elternteil nicht arbeite und sich ganz auf die Familie konzentriere. Diese Aufteilung zeigt eine tendenzielle Mehrheit zugunsten der doppelten Erwerbstätigkeit bei Eltern, besonders unter jüngeren Generationen. Interessant ist, dass sich die Ansichten der Jugendlichen nicht signifikant nach Geschlecht unterscheiden, wohl aber nach sozioökonomischem Hintergrund und politischen Präferenzen.
Jugendliche aus finanzschwächeren Haushalten, mit einem Einkommen unter 30.000 US-Dollar im Jahr, tendieren eher dazu, dass ein Elternteil zu Hause bleiben und sich um die Familie kümmern sollte. Dies kann das Bedürfnis widerspiegeln, dass bei geringeren finanziellen Möglichkeiten die Betreuung und emotionale Unterstützung im familiären Umfeld als besonders wertvoll angesehen wird. Dagegen sehen Jugendliche aus Haushalten mit höheren Einkommensklassen (über 75.000 US-Dollar jährlich) zumeist keinen Nachteil darin, wenn beide Eltern beruflich aktiv sind.
Diese Gruppe schätzt womöglich die finanziellen und kulturellen Vorteile, die mit der doppelten Erwerbsarbeit einhergehen, wie mehr Ressourcen und Vorbilder für Unabhängigkeit und Gleichstellung. Auch die politische Orientierung spielt eine Rolle: Jugendliche, die sich republikanisch oder konservativ positionieren, bevorzugen mit 53 Prozent eher das Modell, bei dem ein Elternteil zuhause bleibt; demokratisch orientierte Teens befürworten zu 65 Prozent die Erwerbstätigkeit beider Eltern. Diese Gegensätze spiegeln gesellschaftliche Werte wider, die sich um traditionelle Rollenverteilungen und moderne Gleichstellung drehen. Die Sichtweise auf die Frage, welcher Elternteil zu Hause bleiben sollte, wenn ein Elternteil nicht arbeitet, ist ebenfalls bemerkenswert. Unter den Jugendlichen, die ein Elternteil bei der Kinderbetreuung bevorzugen, sprechen sich 61 Prozent dafür aus, dass die Mutter diese Rolle übernimmt.
Nur drei Prozent meinen, dass dies die Aufgabe des Vaters sein sollte, während 36 Prozent keinen Unterschied sehen. Diese Ergebnisse illustrieren, dass klassische Geschlechterrollen, obwohl in der Gesellschaft zunehmend hinterfragt, zumindest bei Jugendlichen im Bereich der familiären Arbeitsteilung noch tief verwurzelt sind. Auch politische Einstellungen beeinflussen hier die Haltung: Republikanische Jugendliche befürworten mit größerer Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter im Haushalt bleibt, als demokratische Jugendliche. Im Bereich der Verantwortlichkeiten im Alltag wünschen sich Jugendliche überwiegend eine gleichmäßige Verteilung der Aufgaben zwischen beiden Elternteilen. Die meisten Teenager finden, dass gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern, Disziplinarmaßnahmen und Unterstützung bei den schulischen Aufgaben von Mutter und Vater gleichermaßen übernommen werden sollten.
Dieses Ergebnis unterstreicht eine moderne Sichtweise, in der Elternschaft als partnerschaftliche Aufgabe gesehen wird. Weniger Einigkeit herrscht jedoch bei finanziellen Aspekten und der Pflege bei Krankheit. 42 Prozent der Jugendlichen sehen den Vater vorwiegend als Erziehenden für den Lebensunterhalt verantwortlich, während nur zwei Prozent die Mutter dafür mehrheitlich zuständig sehen. Ähnlich denken sie bei der Pflege kranker Kinder, wobei 43 Prozent die Mutter als Hauptbeauftragte nennen. Dennoch bevorzugt der Großteil auch hier einen Ausgleich und die Beteiligung beider Eltern.
Im Vergleich zu Jugendlichen stehen Erwachsene den Fragen teilweise anders gegenüber. In einer Umfrage von 2023 bis 2024 äußerten 55 Prozent der Erwachsenen, dass Kinder besser dran seien, wenn ein Elternteil die Familie fokussiert, während lediglich 43 Prozent bejahten, dass beide Eltern berufstätig sein können, ohne Nachteile für die Kinder. Zudem sind Erwachsene weniger geneigt als Jugendliche, traditionelle Rollen aufzubrechen – 59 Prozent der Erwachsenen meinen, es sei egal, welcher Elternteil im Haushalt bleibt, aber 40 Prozent sagen, dass es am besten die Mutter sei. Diese Unterschiede zwischen Adulten und Jugendlichen deuten auf eine Generationenkonvergenz hin, in der jüngere Menschen mehr Offenheit gegenüber diversifizierten Elternrollen zeigen. Betrachtet man die gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen, so zeigt sich, dass die Entscheidung, ob ein Elternteil zuhause bleibt oder beide Eltern arbeiten, viele Faktoren berücksichtigt: finanzielle Notwendigkeiten, soziale Absicherung, die Verfügbarkeit von Betreuungsangeboten und persönliche Werte.
Familienmodelle variieren stark, vom klassischen Alleinverdienermodell bis zum dualen Aktivitätsmodell oder auch zu flexiblen Arbeitszeitlösungen und Homeoffice. Die Forschungslage zu den Auswirkungen auf Kinder ist differenziert. Finanzielle Stabilität durch zwei Einkommen kann Kindern zugutekommen, indem sie mehr Ressourcen für Bildung, Freizeit und Gesundheit ermöglicht. Die familiäre Bindung und emotionale Unterstützung profitieren hingegen häufig von der Präsenz eines Elternteils, der mehr Zeit zuhause verbringt. Ein ausgewogenes Gleichgewicht, verbunden mit hoher Qualität der Betreuung und liebevoller Beziehungsgestaltung, scheint entscheidender zu sein als die reine Anzahl der Arbeitsstunden pro Elternteil.
Besonders hervorzuheben ist die gesellschaftliche Entwicklung hin zu mehr partnerschaftlicher Elternschaft. Jugendliche wünschen sich, dass Vater und Mutter gleichermaßen Verantwortung für Erziehung, Zuwendung und Haushalt übernehmen. Diese progressive Haltung ist wichtig für langfristige Gleichstellungserfolge und das Wohlbefinden der nächsten Generation. Die politische und kulturelle Landschaft beeinflusst die Erwartungen und Vorstellungen der Familien, weshalb auch gesellschaftliche Debatten und politische Entscheidungen die Rahmenbedingungen für Elternarbeit gestalten sollten. Abschließend lässt sich sagen, dass es keine allgemeingültige Antwort darauf gibt, ob Kinder besser dran sind, wenn ein Elternteil zuhause bleibt oder wenn beide arbeiten.
Die individuellen Bedürfnisse der Familie, die finanzielle Situation, die persönlichen Werte und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen spielen eine wesentliche Rolle. Besonders im Lichte der jüngsten Studienergebnisse ist es wichtig, Eltern und Gesellschaft darin zu unterstützen, flexible Lösungen zu finden, die sowohl das wirtschaftliche Wohlergehen sichern als auch das soziale und emotionale Familienleben fördern. Die Zukunft gehört einer vielfältigen Sicht auf Elternschaft, die traditionelle Rollen aufbricht und Raum für neue Lebensmodelle schafft, bei denen Kinder in einem liebevollen und gesicherten Umfeld aufwachsen können – ganz egal, ob ein oder beide Eltern berufstätig sind.