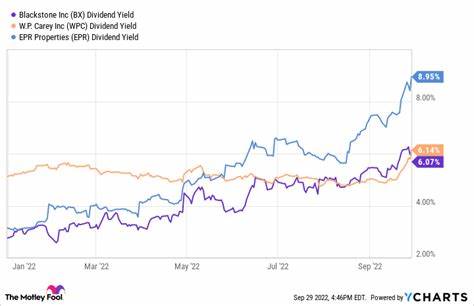In den letzten Jahren hat sich ein beunruhigender Trend im internationalen wissenschaftlichen Austausch abgezeichnet: Zahlreiche wissenschaftliche Konferenzen, die traditionell in den Vereinigten Staaten abgehalten wurden, verlagern ihre Veranstaltungen zunehmend ins Ausland oder werden aufgrund von Einreiseunsicherheiten verschoben beziehungsweise abgesagt. Die Ursache hierfür sind vor allem zunehmende Befürchtungen unter Forscherinnen und Forschern aus dem Ausland hinsichtlich der US-amerikanischen Grenz- und Visapolitik. Dieser Trend hat weitreichende Folgen für die USA als Wissenschaftsstandort, aber auch für die globale Forschungslandschaft. Die Vereinigten Staaten standen lange Zeit als führendes Land für wissenschaftliche Innovationen und Forschungsergebnisse im Fokus internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Präsenz renommierter Universitäten, Forschungsmöglichkeiten und nicht zuletzt die häufig in den USA abgehaltenen internationalen Konferenzen machten das Land zu einem Magneten für den globalen akademischen Austausch.
Doch die wachsende Restriktion bei Einreisebestimmungen, verschärfte Kontrollen an den Grenzen sowie eine zunehmend politische Einflussnahme im Visaprozess haben zu erheblichen Unsicherheiten geführt. Eine Vielzahl ausländischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verweigert mittlerweile die Teilnahme an US-Konferenzen, aus Angst vor langwierigen oder sogar fehlgeschlagenen Einreiseverfahren. Dies betrifft insbesondere Forscherinnen und Forscher aus Ländern, die in den Fokussierungsbereich der US-Einwanderungsbehörden geraten sind oder aus Regionen mit politischen Spannungen stammen. Die daraus resultierende Verunsicherung hat Veranstalter dazu veranlasst, Konferenzen entweder komplett abzusagen oder auf andere Länder mit offeneren oder kalkulierbareren Einreisebestimmungen zu verlagern. Diese Entwicklung ist besonders problematisch, weil wissenschaftliche Konferenzen zentrale Plattformen zum Austausch von Erkenntnissen, Netzwerkbildung und zur Anbahnung von internationalen Kooperationen darstellen.
Wenn Forscherinnen und Forscher nicht mehr in der Lage sind, unkompliziert zusammenzukommen, leidet die Qualität und Geschwindigkeit des wissenschaftlichen Fortschritts. Der Austausch von innovativen Ideen, der Diskurs über kritische Forschungsergebnisse und der Aufbau von globalen Forschungsnetzwerken werden erschwert. Für die USA bedeutet dies nicht nur einen Imageverlust als offene Wissenschaftsnation, sondern auch den Verlust einer führenden Rolle in vielen Forschungsbereichen. Die Gründe für die restriktiveren Einreisepraktiken liegen unter anderem in der nationalen Sicherheitspolitik, die seit einigen Jahren zunehmend durch verstärkte Kontrollen und genauere Überprüfungen geprägt ist. Die US-Grenzbehörden haben ihre Maßnahmen verschärft, insbesondere im Zusammenhang mit Aufenthaltszwecken von Wissenschaftlern.
Berichte über längere Kontrollzeiten, unangemessene Befragungen und gar Zurückweisungen trotz gültiger Visa haben sich gehäuft. Diese Situationen erzeugen ein Klima der Angst und Unsicherheit, welches besonders junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie internationale Nachwuchsforscherinnen und -forscher abschreckt. Neben den direkten Auswirkungen auf Konferenzen wirkt sich die restriktivere US-Einwanderungspolitik auch auf längerfristige Forschungskarrieren aus. Internationale Talente entscheiden sich zunehmend dafür, Studien- oder Arbeitsplätze außerhalb der USA anzunehmen. Länder wie Kanada, Deutschland, Australien und die europäischen Staaten positionieren sich als attraktive Alternativen mit unkomplizierteren Einreise- und Visabedingungen.
Dies führt zu einem Brain Drain, der die Innovationskraft der US-Forschungseinrichtungen schwächt. Der wissenschaftliche Austausch ist seit jeher ein globales Unternehmen, das auf Offenheit und Mobilität beruht. Einschränkungen in diesem Bereich schlagen sich unmittelbar negativ nieder. Die Verlegung von Konferenzen ins Ausland setzt ein deutliches Zeichen, dass die USA im internationalen Wettbewerb um wissenschaftliche Exzellenz zurückfallen könnten, wenn die Einwanderungspolitik nicht angepasst wird. Es gibt inzwischen zahlreiche Stimmen aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und Branchenverbänden, die vor den Folgen warnen und eine Reform fordern.
Gleichzeitig zeigen einige Veranstalter flexible und innovative Ansätze, um der Situation zu begegnen. So werden hybride Konferenzen mit digitalen und physischen Präsenzmöglichkeiten organisiert, um auch Forschern mit Einreiseproblemen eine Teilnahme zu ermöglichen. Allerdings kann dies den direkten persönlichen Austausch nur begrenzt ersetzen. Der Aufbau von Vertrauen, spontane Diskussionen im informellen Rahmen oder das Knüpfen von tiefgehenden Kooperationen bleiben physisch besser möglich. Für die internationale Wissenschaftsgemeinschaft ist die Rückkehr zu offenen, unkomplizierten und fairen Mobilitätsbedingungen essenziell.
Wissenschaft lebt davon, dass Experten aus aller Welt ihre Erkenntnisse teilen und gemeinsam an komplexen Fragestellungen arbeiten können. Nationalistische Abschottung oder restriktive Visapolitik sind kontraproduktiv und verringern das Potential wissenschaftlicher Innovationen. Die aktuelle Situation wirkt als Weckruf für die US-Politik. Um der eigenen Wettbewerbsfähigkeit nicht zu schaden, sind die USA gut beraten, sicherheitsrelevante Anliegen mit dem Erhalt einer offenen Forschungsinfrastruktur in Einklang zu bringen. Die Einführung transparenter, zeitlich begrenzter und vorhersehbarer Visaverfahren für Wissenschaftler könnte ein Schritt in diese Richtung sein.