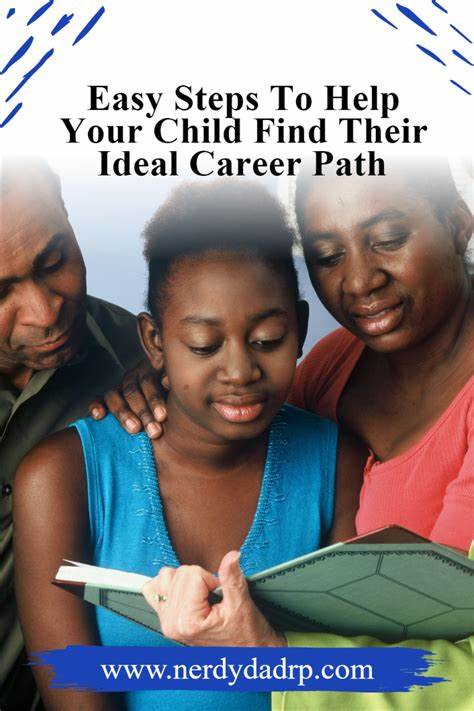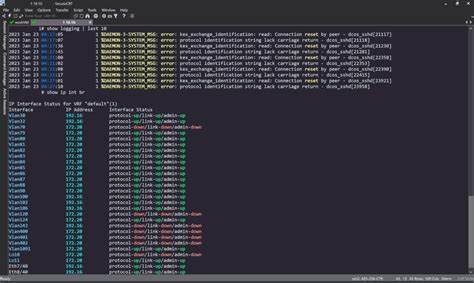In einer der bedeutendsten politischen Entscheidungen im Gesundheitswesen der Vereinigten Staaten hat der Bundesstaat Oregon kürzlich mit dem Gesetz SB 951 eine drastische Regelung verabschiedet, die private Equity-Firmen und große Unternehmen daran hindert, die Kontrolle über ärztliche Praxen zu übernehmen. Dieses Gesetz stellt einen wichtigen Wendepunkt im Kampf gegen die zunehmende Kommerzialisierung und Industrialisierung der medizinischen Versorgung dar. Besonders die großen Player wie UnitedHealth Group, eine der größten Krankenversicherungen und Gesundheitsdienstleister womöglich des Landes, sowie private Finanzinvestoren mussten eine klare Niederlage einstecken. Oregon wird dadurch zum Vorreiter, der das traditionelle Modell von ärztlicher Selbstbestimmung gegenüber der wachsenden Macht der Konzerne verteidigt und die Rechte von Patienten und Medizinern in den Mittelpunkt stellt. Die Ursprünge des Problems liegen tief und zeichnen ein Bild vom stetigen Wandel im US-Gesundheitssystem.
Jahrzehntelang hatten Ärzte, zumindest in den USA, eine eigenständige Rolle, die sich durch Autonomie, ethische Verantwortung und direkte Patientenversorgung auszeichnete. Doch über die letzten Jahrzehnte veränderte sich das Bild nachhaltig, vor allem durch die zunehmende Beteiligung von privaten Investoren, großen Krankenversicherungen und Konzernen, die über umfangreiche finanzielle Ressourcen verfügen und durch Unternehmensstrukturen wie Management-Dienstleistungsorganisationen (MSOs) ärztliche Einrichtungen kontrollieren und steuern. Diese Form der Kontrolle führt oft zu einem Interessenkonflikt, denn die Zielsetzung von Unternehmen ist vornehmlich die Gewinnmaximierung, während die medizinische Ethik und die Bedürfnisse der Patienten hinter wirtschaftlichen Überlegungen zurücktreten. Das neue Gesetz in Oregon zielt genau auf diese Problematik ab. Es schließt zuvor bestehende Schlupflöcher in den sogenannten Corporate Practice of Medicine (CPOM) Gesetzen, die verhindern sollen, dass nicht-ärztliche Unternehmen medizinische Praxen kontrollieren.
Damit verlagert das Gesetz die Entscheidungsgewalt zurück zu den medizinischen Fachkräften – Ärzte erhalten wieder die Kontrolle über Personalentscheidungen, klinische Abläufe, Abrechnungs- und Vertragsverhandlungen. Das Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Klauseln wie Non-Compete und Gag-Klauseln stärkt zusätzlich die Autonomie von medizinischem Personal und schützt vor Missbrauch durch Konzerne, die Ärzte an sich binden und unbequeme Arbeitsbedingungen erzwingen. Die politischen Auseinandersetzungen rund um das Gesetz waren dabei hoch intensiv. UnitedHealth Group, Optum als deren profitstärkste Einheit und andere Großkonzerne investierten Millionen in Lobbyarbeit gegen das Gesetz. Auch Tech-Riesen wie Amazon schalteten sich ein, wohlwissend, dass ein Präzedenzfall in Oregon ein Signal an weitere Bundesstaaten sein könnte.
Trotz dieses Drucks gelang es den Befürwortern, unterstützt von medizinischem Personal, Patientenvertretern und progressiven politischen Kräften, das Gesetz erfolgreich durch das Parlament zu bringen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die öffentliche Empörung über die Übernahme der Corvallis Clinic durch Optum im Jahr 2024. Die Klinik, die sich in einer finanziellen Notlage befand, wurde von der großen Einheit der UnitedHealth Group quasi aufgekauft, nachdem eine Sicherheitslücke bei Change Health, einer Tochtergesellschaft, zu Ausfällen im Zahlungsverkehr geführt hatte. Das führte zu einer dramatischen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der medizinischen Versorgung vor Ort. Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte verließen die Einrichtung, Patienten verloren den Zugang zu Spezialisten, und die Qualität der Versorgung sank massiv.
Besonders gravierend war die Situation, weil mehrere betroffene Abgeordnete des Staatsparlaments selbst Patientinnen waren und öffentlich über ihre negativen Erfahrungen berichteten. Diese Beispiele schärften das Bewusstsein in der Bevölkerung und deren Vertreter für die Gefahren der Kommerzialisierung der Gesundheitsversorgung, wie sie von Konzernen und Private Equity vorangetrieben wird. Die Kritik an den großen Playern basiert nicht nur auf Einzelfällen. Studien und Berichte zeigen, dass Private Equity-geführte und von Großfirmen kontrollierte medizinische Einrichtungen oft höhere Kosten verursachen, bei zugleich geringerer Versorgungsqualität. Die administrative Überlastung für Ärztinnen und Ärzte nimmt zu, während patientenorientierte Leistungen zurückgedrängt werden.
Burnout bei medizinischem Personal steigt und lange Wartezeiten sowie Kapazitätsengpässe werden häufiger. Ein weiterer Aspekt, den das Gesetz adressiert, ist das Machtgefälle bei der Kapitalbeschaffung. Großkonzerne verfügen über Zugang zu günstigen Krediten und Kapitalmärkten, was sie in die Lage versetzt, Praxen zu übernehmen oder finanziell zu überrollen. Einzelne medizinische Einrichtungen, die auf normale Bankkredite angewiesen sind, haben kaum Chancen, mit solch massivem Kapitaldruck zu konkurrieren. Ein teuflischer Kreislauf entsteht, weil finanzielle Abhängigkeiten es den Firmen ermöglichen, medizinische Versorgung zu standardisieren – oft zu Lasten der Qualität – und gleichzeitig die Verhandlungsposition gegenüber Krankenkassen und Lieferanten zu verbessern.
Kritiker des Gesetzes weisen darauf hin, dass durch das Verbot der Unternehmensübernahmen auch die Patientenversorgung leiden könnte, wenn Praxen ohne ausreichende Finanzierung dastehen. Es wird bezweifelt, ob kleinere Einrichtungen ohne Kapitalgeber in der Lage sind, etwa modernste Medizintechnik anzuschaffen oder Investitionen in Innovationen zu tätigen. Allerdings zeigen Untersuchungen, dass viele Übernahmen durch Konzerne eher mit der Kapazitätsreduzierung und Kostensenkung einhergehen, statt mit nennenswertem Ausbau oder Innovation. Die neue Regierungsinitiative sieht deshalb zwar keine direkten Kapitalhilfen vor, doch ist es klar, dass für eine nachhaltige Verbesserung ein neues Finanzierungsmodell entwickelt werden muss, das Medizinern und kleineren Praxen den Zugang zu Kapital erleichtert und faire Bedingungen schafft. Diese komplexen Herausforderungen stehen beispielhaft für den Kampf gegen die Monopolisierung und den Einfluss großer Konzerne im US-Gesundheitssystem insgesamt.
Neben Oregon gibt es weitere Bundesstaaten wie Pennsylvania, Massachusetts oder Indiana, die versuchen, mit Regulierungen und Wettbewerbsvorgaben gegen die Machtkonzentration im Gesundheitssektor vorzugehen. Auf Bundesebene entstehen ebenfalls Reformbestrebungen, die etwa gegen Pharmacy Benefit Manager vorgehen, die als wesentliche Mittelsmänner bei Arzneimitteln den Markt dominieren und Preisgestaltung beeinflussen. Die Entwicklungen in Oregon könnten deshalb eine Vorreiterrolle spielen und Vorbildcharakter für weitere Maßnahmen mit direktem Einfluss auf das Gesundheitssystem entfalten. Die Grundidee, die hinter dem Gesetz SB 951 steht, ist einfach und doch revolutionär: medizinische Versorgung und ärztliche Entscheidungskompetenz dürfen nicht den Finanzinteressen großer Unternehmen unterworfen werden. Stattdessen sollen medizinische Fachkräfte wieder die Kontrolle zurückerlangen, um qualitativ hochwertige Versorgung und ethisch verantwortliches Handeln sicherzustellen.
Angesichts der rasant steigenden Gesundheitskosten, wachsender Ungleichheit im Zugang zu Leistungen und der zunehmenden Belastung für Ärztinnen und Ärzte gilt es, eine Balance zwischen Effizienz, Qualität und sozialer Verantwortung herzustellen. Darüber hinaus verdeutlicht das Gesetz ein wachsendes gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass Gesundheit kein Industrieprodukt sein darf. Die Reaktionen aus der Wirtschaft zeigen indes, dass sich der Widerstand gegen solche Reformen auch künftig nicht auflösen wird. Es zeichnet sich ab, dass große Konzerne womöglich zu Gegenmaßnahmen greifen werden, etwa durch eine Kapitalverweigerung oder juristische Schlachten, um ihre Geschäftsmodelle zu verteidigen. Allerdings könnte die neue Regelung in Oregon, gestützt durch engagierte Patientengruppen, Gesundheitsexperten und politische Unterstützer, den Weg zu einer nachhaltigeren, gerechteren Gesundheitsbranche bahnen.
Letztlich erscheint die Entwicklung in Oregon als wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Gesundheitssystem, das nicht länger primär von Kapitalinteressen gelenkt wird, sondern wieder die Bedürfnisse von Patientinnen, Patienten und medizinischem Fachpersonal in den Mittelpunkt stellt. Die Stärkung der ärztlichen Autonomie hat das Potenzial, administrative Kosten zu senken, moralische Spannungen zwischen Ärzten und Management zu verringern und die Versorgung in einer Zeit steigender Herausforderungen zu verbessern. Im internationalen Vergleich bietet die US-amerikanische Gesundheitslandschaft wegen ihrer Kommerzorientierung oft Anlass zur Kritik und Besorgnis, während Europas System vielfach stärker durch staatliche oder gemeinnützige Strukturen geprägt ist. Der Schritt Oregons könnte deshalb auch Impulse für einen globalen Diskurs setzen, wie die richtige Balance zwischen privater und professioneller Verantwortung in der Medizin aussehen sollte. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Oregons Verbot der Unternehmensübernahmen von ärztlichen Praxen nicht nur eine regionale politische Entscheidung ist.
Es stellt einen Versuch dar, die Mechanismen von Macht und Kapital im Gesundheitswesen neu zu kalibrieren. Die Folgen dürften weit über die Landesgrenzen hinaus spürbar sein und Einfluss auf zukünftige Gesundheitsreformen haben. Für Patienten und Mediziner gleichermaßen bedeutet es die Aussicht auf mehr Kontrolle, mehr Ethik und hoffentlich bessere Versorgung. Es bleibt zu beobachten, wie sich das Gesetz in den kommenden Jahren in der Praxis bewährt und ob andere Bundesstaaten und Länder diesem Mut folgen werden, um die Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen und medizinischer Fürsorge neu zu definieren.