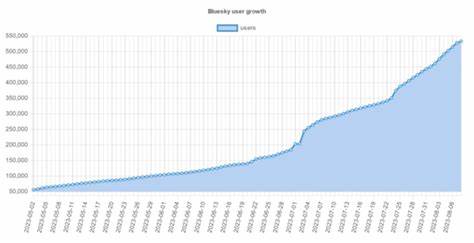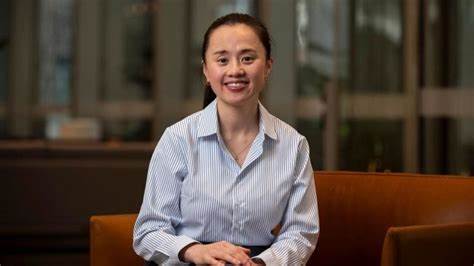Die Welt steht vor einer Herausforderung, deren Dringlichkeit kaum zu überschätzen ist: Die Temperaturen auf der Erde bleiben in den kommenden fünf Jahren voraussichtlich auf Rekordniveau oder in der Nähe davon. Eine aktuelle Prognose der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) zeigt deutlich, wie sehr die globale Erwärmung das Klima weiterhin beeinflussen wird und welche Folgen daraus für unser Leben, das Ökosystem und die Weltwirtschaft entstehen können. Die Erkenntnisse aus dem Bericht sind nicht nur alarmierend, sondern auch ein weiterer Weckruf für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, dringend notwendige Maßnahmen einzuleiten und umzusetzen. Laut dem WMO-Bericht besteht eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines der Jahre zwischen 2025 und 2029 das bislang wärmste Jahr übertrifft, wobei 2024 derzeit das Rekordjahr mit den höchsten Temperaturen ist. Ebenso weist die Prognose eine 86-prozentige Chance auf, dass in diesem Zeitraum ein Jahr die globale Mitteltemperatur um mehr als 1,5 Grad Celsius über dem Niveau der vorindustriellen Zeit (1850-1900) liegen wird.
Besonders bedeutend ist die 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die durchschnittliche Erwärmung über die fünf Jahre von 2025 bis 2029 sogar dauerhaft mehr als 1,5 Grad Celsius beträgt. Diese Werte verdeutlichen den Trend zu einer sich beschleunigenden Erderwärmung und unterstreichen die Dringlichkeit weiterer Klimaschutzmaßnahmen. Das Erreichen oder Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze ist von besonderer Relevanz, da diese Marke im Pariser Abkommen als kritischer Schwellenwert definiert wurde, dessen Überschreitung schwere und oft irreversible klimatische Auswirkungen nach sich ziehen könnte. Die vorläufigen Daten zeigen, dass sich die Erde schon jetzt in einem Zustand befindet, der möglicherweise schneller eine solche Überschreitung erleben wird als erwartet. Dennoch ist das langfristige, über Jahrzehnte gemittelte globale Temperaturanstieg noch leicht unterhalb dieses Grenzwertes und bietet somit theoretisch noch Chancen zur Eindämmung.
Die Erwärmung ist dabei nicht gleichmäßig verteilt. Besonders die Arktis heizt sich deutlich stärker auf als der globale Durchschnitt. Die Prognosen für die kommenden Jahre zeigen, dass die Temperaturen in der Arktis in den verlängerten Wintern (November bis März) über 2025 bis 2029 um mehr als das Dreifache der weltweiten Durchschnittserwärmung steigen werden. Das entspricht einem Anstieg um rund 2,4 Grad Celsius über das Niveau des Basiszeitraums von 1991 bis 2020. Diese Entwicklung hat weitreichende Konsequenzen nicht nur für den Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten in der Polarregion, sondern beeinflusst auch globale Wettermuster, den Meeresspiegelanstieg und das Schmelzen von Meereis und Gletschern.
Die projizierten Veränderungen wirken sich auch auf die Meeresökosysteme aus. Prognosen für den März zwischen 2025 und 2029 zeigen einen weiteren Rückgang der Meereis-Konzentration in kritischen Gebieten wie dem Barentssee, dem Beringmeer und dem Ochotskischen Meer. Das weitere Abschmelzen trägt nicht nur zu einem Anstieg des Meeresspiegels bei, sondern beschleunigt auch den Temperaturanstieg in den Polarregionen, wodurch ein Teufelskreis entsteht, der sich immer schneller selbst verstärkt. Regional unterschieden sich die Auswirkungen der Erwärmung zudem stark. So sagen die Klimamodelle für die Monate Mai bis September in der kommenden Dekade veränderte Niederschlagsmuster voraus.
Während Regionen wie die Sahelzone, Nordeuropa, Alaska und Nord-Sibirien mit einer höheren Niederschlagsmenge rechnen können, drohen Gebiete wie der Amazonas mit einer höheren Trockenheit. Die südasiatische Region, die in den letzten Jahren – abgesehen von 2023 – verstärkt feuchtere Bedingungen erlebte, wird diesem Trend gemäß der Prognosen auch in den kommenden Jahren folgen. Allerdings bleibt hierbei zu beachten, dass innerhalb einzelner Jahreszeiten durchaus auch gegenteilige Wetterlagen möglich sind. Die Konsequenzen dieser Veränderungen sind vielfältig und betreffen zahlreiche Bereiche des täglichen Lebens sowie globaler Systeme. Zunehmende Hitzewellen, intensivere Regenfälle und extreme Dürren gehören zu den unmittelbaren Folgen, mit denen Gesellschaft und Wirtschaft umgehen müssen.
Die steigenden Temperaturen führen darüber hinaus zum Abschmelzen von Gletschern und Eisschilden, zur Erwärmung der Weltmeere und zu steigendem Meeresspiegel, was letztlich Ozeanökosysteme bedroht und das Risiko von Überschwemmungen in Küstenregionen erhöht. Die aktuellen Daten sind das Ergebnis der Arbeit eines internationalen Netzwerks von Klimaforschungszentren. Die britische Met Office fungiert hierbei als führendes Zentrum für kurzfristige bis dekadische Klimavorhersagen und koordiniert die Auswertung von über 220 Modellen, die von 15 verschiedenen Instituten weltweit erstellt werden. Die Vereinten Nationen und die WMO setzen damit auf eine breite wissenschaftliche Grundlage, um politische Entscheidungsträger mit verlässlichen Projektionen und wissenschaftlichen Daten zu versorgen. Solche Innovationen sind essentiell, da sie dabei helfen können, Risiken abzuschätzen und frühzeitig Gegenmaßnahmen zu treffen.
Die im Pariser Klimaabkommen festgelegten Ziele, den Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Niveaus zu begrenzen und möglichst bei 1,5 Grad zu stoppen, sind angesichts der aktuellen Prognosen herausfordernd. Die Tatsache, dass temporäre Überschreitungen dieser Schwellenwerte bereits jetzt wahrscheinlicher werden, zeigt, dass die Zeit für effektiven Klimaschutz knapp wird. Um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden, müssen Länder ihre nationalen Verpflichtungen regelmäßig überarbeiten und ambitionierter gestalten. Die kommende UN-Klimakonferenz COP30 wird dabei eine entscheidende Rolle spielen, indem aktualisierte Klimaziele vorgestellt und besprochen werden. Zudem macht der Bericht deutlich, dass jede noch so kleine Erhöhung der Durchschnittstemperaturen spürbare und oft dramatische Folgen nach sich zieht.
Selbst eine Erwärmung um wenige Zehntelgrad kann vermehrt zu gefährlichen Wetterextremen führen, welche Menschenleben gefährden, Infrastruktur zerstören und die wirtschaftliche Stabilität beeinträchtigen. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit, die globale Erwärmung nicht nur zu stoppen, sondern spätestens jetzt aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Geschwindigkeit zu verlangsamen. Technologische Innovationen, gesellschaftliches Engagement und politische Führung sind die Schlüssel, um die Herausforderung Klimawandel zu meistern. Angefangen bei der Förderung erneuerbarer Energien und der Einschränkung fossiler Brennstoffe bis hin zu nachhaltiger Urbanisierung und internationaler Zusammenarbeit – es gibt zahlreiche Ansatzpunkte, die eine Abkehr von der bisher fatalen Entwicklung bewirken können. Gleichzeitig muss die Anpassung an unvermeidliche Veränderungen intensiviert werden, um Mensch und Natur bestmöglich zu schützen.
Die kommenden fünf Jahre werden als kritische Phase in die Klimaentwicklung eingehen und darüber entscheiden, in welchem Maße der Klimawandel noch abgemildert werden kann. Die alarmierenden Prognosen, wie sie die WMO vorlegt, sind mehr als eine wissenschaftliche Momentaufnahme – sie sind ein Appell. Ein Appell an die Weltgemeinschaft, politische Willenskraft zu zeigen, wissenschaftliche Erkenntnisse aufzunehmen und entschlossen zu handeln. Nur so lässt sich verhindern, dass sich die Auswirkungen der hohen Temperaturen weiter verschärfen und irreparable Schäden verursachen. Zusammengefasst zeigt die Analyse der WMO, dass die globale Erwärmung weiterhin voranschreitet und in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich neue Rekorde erreichen wird.
Das Verständnis dieser Entwicklungen ist von großer Bedeutung, um fundierte Entscheidungen für ein nachhaltiges und sicheres Zusammenleben auf unserem Planeten zu treffen. Die Zeit zum Handeln ist jetzt – für eine lebenswerte Zukunft, in der Klimaresilienz und Umweltschutz oberste Priorität haben.