Berufsbezeichnungen begleiten uns in unserer beruflichen Laufbahn wie ein Schatten. Sie sind Teil unserer Identität, sie strukturieren unser Selbstbild und beeinflussen, wie andere uns wahrnehmen. Doch nicht jeder fühlt sich wohl mit diesen festgelegten Kategorien. Einige Menschen, wie der Autor und auch der bekannte Komiker Brian Regan, spüren eine innere Abneigung gegen das simple Labeln ihrer Tätigkeit durch einen Jobtitel. Warum ist das so? Was steckt hinter dieser vermeintlich irrationalen Haltung? Und welche Rolle spielen Tradition, berufliche Identität und gesellschaftliche Erwartungen dabei? Eine eingehende Betrachtung zeigt, dass es oft um mehr geht als nur um simple Namen für Berufe.
Der Prozess der Berufsdefinition ist ursprünglich geprägt vom Bedürfnis, Komplexität zu reduzieren. In großen Organisationen und Wirtschaftssystemen haben sich Berufsbezeichnungen entwickelt, um Aufgaben klar zuzuordnen, Verantwortlichkeiten zu definieren und damit eine effiziente Zusammenarbeit zu gewährleisten. Labels erleichtern die Kommunikation, erleichtern Stellenbeschreibungen und ermöglichen Recruitern, passende Kandidaten zu finden. Dieses System ist ein praktikables Mittel in der Business-Welt, in der kurze Beschreibungen und klare Vorstellungen oft notwendig sind. Gleichzeitig entsteht hier aber ein entscheidendes Dilemma: Menschen leiden innerlich daran, zu sehr vereinfacht und starr kategorisiert zu werden.
Berufsbezeichnungen laufen Gefahr, die vielfältigen Facetten einer Person auf eine übersimplifizierte Form zu reduzieren. Diese Reduktion engt ein, wirkt wie ein Käfig, in dem man sich nicht frei entfalten kann. Im Fall des genannten Autors zeigte sich das ganz klar in seiner Ambivalenz gegenüber der Berufsbezeichnung „Design Engineer“. Während er diesen Titel ursprünglich mit Stolz getragen hat, fühlte er sich mit wachsender Verbreitung des Begriffs zunehmend weniger daran gebunden, ja fast abgestoßen davon. Brian Regan, dessen humoristische Arbeit und Gedanken einem breiteren Publikum bekannt sind, beschreibt ähnliche Gefühle.
In einem Interview erzählt er davon, wie er sich weigert, auf eine leicht definierte Rolle reduziert zu werden – sei es das charakteristische Verhalten auf der Bühne oder ein bestimmtes Image, das ihm zugeschrieben wird. Seine Abneigung gegen das Schubladendenken hat ihn zwar daran gehindert, den größten kommerziellen Erfolg zu erzielen, doch es stärkt gleichzeitig seine persönliche künstlerische Freiheit. Er will nicht „der Typ sein, der so und so ist“, sondern mehrdimensionale Perspektiven einnehmen und sich weiterentwickeln können. Diese Haltung ist nachvollziehbar und spiegelt eine fundamentale menschliche Sehnsucht wider: das Bedürfnis nach individueller Freiheit und Selbstbestimmung. Ein festgelegter Jobtitel kann als Widerspruch dazu empfunden werden, weil er suggeriert, dass man genau in dieses eine Muster passen muss.
Doch wir sind mehr als nur Funktionen oder Berufsbilder. Unsere Fähigkeiten reichen oft weit über die Grenzen dessen hinaus, was ein Titel beschreibt. Wir wollen nicht nur definierte Aufgaben abarbeiten, sondern unsere Kreativität ausleben, neue Aufgaben entdecken und unterschiedliche Rollen übernehmen. Im digitalen Zeitalter, in dem sich Arbeitsweisen, Technologien und Branchen rapide verändern, werden herkömmliche Berufsbezeichnungen oft ihrer eigentlichen Funktion nicht mehr gerecht. Neue Berufsprofile entstehen, traditionelle Grenzen verschwimmen.
Im Bereich der Webentwicklung beispielsweise gibt es Titel wie „Full-stack Designer“, „UX Engineer“ oder „Design Technologist“. Diese Bezeichnungen versuchen, hybride Fähigkeiten und komplexe Rollen abzubilden. Trotzdem bleibt die Herausforderung bestehen, dass Menschen sich nicht vollständig mit einem Begriff identifizieren können, der sie auf wenige Worte reduziert. Das Streben danach, sich nicht definieren zu lassen, hat auch seine Schattenseiten. Gerade im Berufsleben, wo Netzwerkbildung, Auffindbarkeit und persönliche Vermarktung wichtig sind, können klare Berufsbezeichnungen Vorteile bringen.
Ein präzises Label erzeugt Vertrauen und erleichtert anderen, das eigene Angebot und Können einzuschätzen. Wer zu unklar bleibt, läuft Gefahr, übersehen oder nicht ernst genommen zu werden. Im Umkehrschluss kann die bewusste Abwendung von Standardtiteln als Schwierigkeit wahrgenommen werden, sich im Markt zu positionieren. Brian Regan selbst gibt zu, dass seine Weigerung, sich festlegen zu lassen, auch seine kommerzielle Reichweite eingeschränkt hat. Dennoch sollte die Gesellschaft sensibler dafür werden, dass Menschen oft ein vielschichtigeres Profil besitzen, als es klassische Berufsbezeichnungen ausdrücken können.
Insbesondere in kreativen und interdisziplinären Arbeitsfeldern ist es wichtig, die Vielfältigkeit der Tätigkeiten anzuerkennen. Berufstitel sollten nicht als starre Käfige verstanden werden, sondern als dynamische Etiketten, die sich an persönliche Entwicklung und Wandel anpassen lassen. Der Autor beschreibt, wie sich seine eigene berufliche Entwicklung in den letzten Jahren vollzogen hat: Von einem einfachen „Designer“ über „Design Engineer“ hin zu Tätigkeiten, die von der Problemerkennung und Stakeholder-Interaktion bis hin zur Implementierung komplexer technischer Lösungen reichen. Statt sich mit einem Begriff zufrieden zu geben, beschreibt er eine stetige Expansion seines Aufgaben- und Verantwortungsbereichs. Dabei sucht er bewusst Rollen, in denen Grenzen zwischen Disziplinen begehbar sind.
Dies bestätigt die Beobachtung, dass besonders in kleineren, flexiblen Teams die Durchlässigkeit von Berufsfeldern eine größere Entfaltung ermöglicht. Dieses Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit von Labels zur Orientierung und dem Wunsch nach individueller Freiheit bleibt eine Herausforderung für viele Berufstätige. Es erfordert ein neues Verständnis von beruflicher Identität, das nicht mehr starr an Titeln klebt, sondern die Dynamik einer wandelbaren Arbeitswelt anerkennt. Unternehmen könnten hier flexibler reagieren, Rollenbeschreibungen dynamischer gestalten und die Vielseitigkeit der Beschäftigten stärker fördern. Abschließend zeigt die Reflexion über die Abneigung gegenüber Berufsbezeichnungen, wie sehr wir Menschen nach Einzigartigkeit und echter Selbstdarstellung streben.
Jobtitel sind notwendig und nützlich, aber sie dürfen uns nicht einschränken oder definieren. Die Erfahrungen von Brian Regan und der Autor selbst verdeutlichen, dass es Mut braucht, sich nicht festlegen zu lassen, auch wenn dies manchmal Karriere-Nachteile mit sich bringt. Die Zukunft der Arbeit verlangt von uns, dieses Spannungsverhältnis zu akzeptieren und gleichzeitig neue Wege zu finden, wie persönliche Identität und berufliche Bezeichnungen harmonieren können. So entsteht Raum für mehr Vielfalt, Kreativität und die wertvolle Individualität jedes Einzelnen in der Arbeitswelt von morgen.




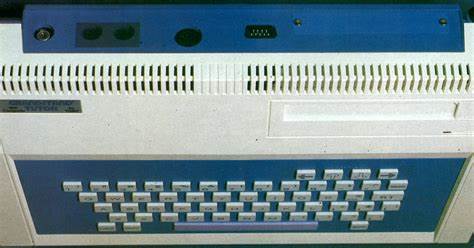
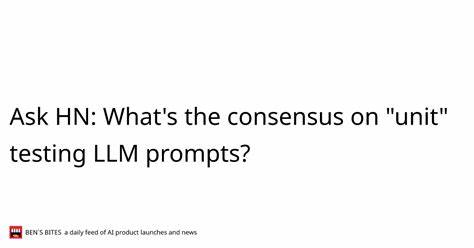
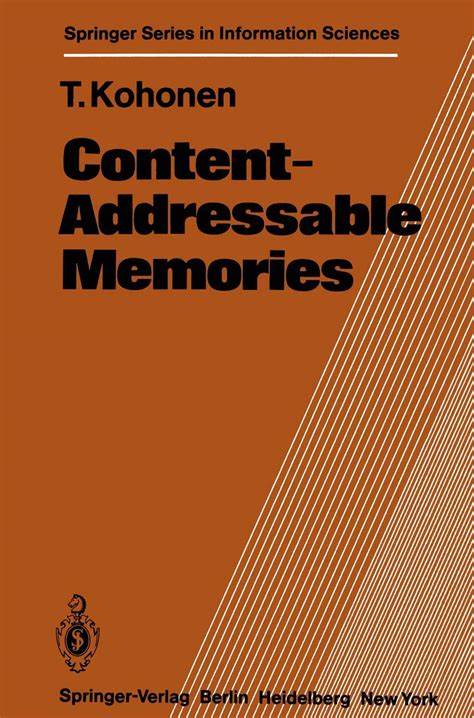
![What determines the size of an atom? [video]](/images/CD96B2BF-8ACD-4260-8183-AC62D8EFA160)

