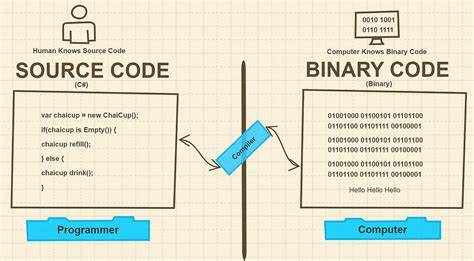In einer Welt, die immer digitaler und vernetzter wird, verändert sich unser Umgang mit Zeit, Arbeit und Fürsorge auf fundamentale Weise. De-Caring, ein Begriff, der auf das nachlassende Gefühl der Fürsorge gegenüber der eigenen Zukunft und dem Unsicheren hinweist, gewinnt in diesem Kontext zunehmend an Bedeutung. Besonders durch den Einzug von Künstlicher Intelligenz (KI) und optimierten digitalen Anwendungen wird unsere Beziehung zur Zukunft neu definiert. Dabei stellt sich die Frage: Verlieren wir durch die Vereinfachung und die ständige Optimierung der Gegenwart das essenzielle menschliche Bedürfnis, uns um das Kommende zu kümmern und es mit Aufmerksamkeit zu betrachten? Die moderne Technologie verspricht uns eine Welt der Vorhersehbarkeit, in der jede noch so kleine Unwägbarkeit eliminiert wird. Doch welche Konsequenzen hat diese „Entsorgung“ der Zukunft als Sorgequelle auf unser Denken, Fühlen und unsere Freiheit? Das Phänomen Doomscrolling macht diese Problematik besonders sichtbar.
Der unablässige Drang, kontinuierlich Nachrichten und Informationen zu konsumieren, ist eine Instinktreaktion, ähnlich der der Fluchttiere, die einer nahenden Bedrohung mit gesteigerter Wachsamkeit begegnen. Im digitalen Zeitalter jedoch scheint es kein Entkommen mehr zu geben. Die Informationsflut ist endlos, Bildschirme liefern unaufhörlich Neuigkeiten, die uns in einem Zustand permanenter Alarmbereitschaft halten. Trotz der Erschöpfung gelingt es kaum, den Blick abzuwenden – eine paradoxe Dynamik, die zugleich Warnung und Erschöpfung bedeutet. Krisen sind hierbei entscheidende Momente, denn sie sind durch Unvorhersehbarkeit und Brüche mit der Vergangenheit charakterisiert.
Während solche Situationen traditionell Unsicherheit und Angst hervorrufen, bieten die digitale Welt und automatisierte Systeme den Versuch, diese Unwägbarkeiten zu beruhigen – durch Vorhersage, Optimierung und Standardisierung. Die Zukunft wird hier nicht mehr als offenes, unberechenbares Feld betrachtet, sondern als etwas, das mit Algorithmen und KI-Tools zu einem vorhersehbaren und kontrollierbaren Gegenstand gemacht werden kann. Die sogenannte Optimierung der Gegenwart nimmt uns diese Beziehung zur Zukunft als Quelle der Fürsorge. Wenn die Zukunft als fixed und optimiert angenommen wird, entfällt der Bedarf, sich um sie zu sorgen. So argumentiert der Philosoph Byung-Chul Han in seinem Werk „Non-things“ und beschreibt diese Entwicklung als eine Art Anästhesie des menschlichen Bewusstseins.
Die Technologien, die einst dazu dienten, unseren Alltag zu erleichtern und uns Sicherheit zu bieten, mutieren zunehmend zu Kontrollinstrumenten. Virtuelle Assistenten, die uns auf Befehl bedienen, Endlos-Feeds, die uns gebannt halten, und komplett optimierte Tagesabläufe machen eigenständiges Denken, Lesen und Handeln überflüssig beziehungsweise unmöglich. Im Ergebnis droht eine Abhängigkeit von Maschinen zu entstehen, die nicht nur unseren Umgang mit der Welt, sondern das Gefühl der Freiheit selbst einschränkt. Freiheit ist jedoch ohne Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit kaum denkbar. Sie benötigt eine offene Zukunft, die Raum für Möglichkeiten und Entscheidungsfreiheit lässt.
Wenn alles vorhersagbar und automatisiert ist, verlieren Menschen die Fähigkeit und den Willen, die Dinge selbst zu denken. Diese Entwicklung wirft eine Reihe von Fragen auf, die weit über technische Innovationen hinausgehen. Was bedeutet es für das menschliche Selbstverständnis, wenn Technik nicht mehr Werkzeuge sind, sondern übermächtige Akteure, die unser Denken und Fühlen formen? Wie schützen wir die Fähigkeit zur Fürsorge, die nicht bloß das Ergebnis optimierter Prozesse ist, sondern aus Ungewissheit und Verantwortung erwächst? In seinem Buch betont Byung-Chul Han die Gefahr, dass Menschen zunehmend blind werden für die kleinen, alltäglichen Dinge, die unser Leben eigentlich begründen. Das Augenmerk auf das Große und Bedeutende verschiebt sich in Richtung der durch Algorithmen kuratierten Inhalte – mit der Folge, dass das Gewöhnliche, das scheinbar Unbedeutende an Wert verliert. Doch gerade diese kleinen Dinge geben Halt und verankern Menschen im Sein.
Die virtuelle Welt hingegen verspricht Einfachheit, Vorhersehbarkeit und Komfort – Werte, die auf den ersten Blick willkommen scheinen. Doch sie sind ambivalent. Komfort führt zu Trägheit, Vorhersehbarkeit zu Verlust von Kreativität, Einfachheit zu Vereinseitigung des Bewusstseins. Daraus resultiert eine Dynamik, in der Technologien zwar scheinbar befähigen, aber eigentlich betäuben. Daraus ergibt sich die Herausforderung für Individuen und Gesellschaften, Wege zu finden, die digitale Welt mit einer bewussten Praxis der Fürsorge zu verbinden, die nicht in Optimierung und Kontrolle aufgelöst wird.
Es bedarf einer Kultur, die Unsicherheit umfasst und als notwendigen Bestandteil menschlichen Lebens anerkennt. De-Caring ist mehr als ein technisches Phänomen. Es ist Ausdruck einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderung, die unsere Beziehung zur Zeit, zur Arbeit und zu uns selbst neu gestaltet. Der Umgang mit dieser Transformation wird darüber entscheiden, wie und ob zukünftige Generationen Freiheit und Fürsorge in einer digitalisierten Welt leben können. Letztlich erfordert die Gegenwehr gegen das De-Caring eine Rückkehr zu Aufmerksamkeit und Reflexion.