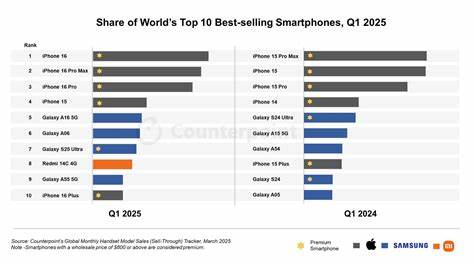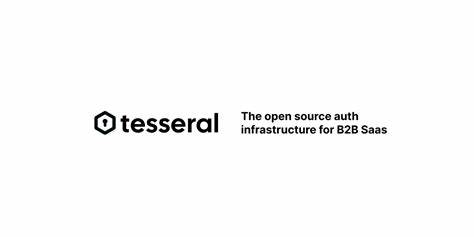Team Topologies ist seit einigen Jahren ein oft diskutiertes Konzept zur Gestaltung moderner Software- und Entwicklungsteams. Das zugrundeliegende Versprechen lautet, durch eine bewusste Strukturierung von Teams und Kommunikationswegen bessere Softwarearchitekturen und effizientere Entwicklungsprozesse zu ermöglichen. Doch hinter diesem Konzept verbirgt sich ein grundlegendes Missverständnis, das sowohl praktische Auswirkungen auf Unternehmen als auch theoretische Schwächen mit sich bringt. Es lohnt sich daher, die Annahmen und Argumentationslinien von Team Topologies kritisch zu hinterfragen und eine differenzierte Sichtweise einzunehmen. Die Ursprünge und Grundannahmen von Team Topologies basieren maßgeblich auf sogenannten Organisationstheorien wie Conway’s Law.
Dieses Gesetz besagt, dass die Architektur eines Systems die Kommunikationsstruktur der Entwicklerorganisation widerspiegelt. Daraus leitet Team Topologies ab, dass eine gezielte Strukturierung der Teams und ihrer Kommunikationswege letztlich die gewünschte Softwarearchitektur ermöglicht. So sollen Teams etwa unabhängig voneinander spezifische Microservices entwickeln, indem unnötige Kommunikation bewusst eingeschränkt wird. Kommunikation zwischen Teams wird als potenzieller Flaschenhals und Störfaktor dargestellt. Doch dieses Modell erfasst nur einen Teil der Realität.
Conway’s Law ist eine empirisch beobachtete Korrelation und beschreibt, dass Organisationsgrenzen oft das Design beeinflussen – nicht aber zwangsläufig bestimmen. In der Praxis gibt es unzählige Beispiele, bei denen Organisationen trotz komplexer oder überlappender Strukturen sehr modulare und flexible Architekturen schaffen. Ebenso können monolithische Systeme auch von kleinen, hochkommunikativen Teams ohne starre Teamgrenzen erfolgreich umgesetzt und weiterentwickelt werden. Das Kernproblem von Team Topologies liegt im Missverständnis des Inverse Conway Maneuver, einer pragmatischen Denkfigur, die besagt: Wenn wir die Organisation passend zur gewünschten Architektur gestalten, erhalten wir das gewünschte Ergebnis. Dieses Schlussfolgerung nehmen die Autoren von Team Topologies ernst und ziehen daraus in der Praxis eine rigide Trennung von Teams und die bewusste Isolierung von Kommunikationskanälen nach sich.
Das Ziel ist ein System aus „einzigen“, klar abgegrenzten Teams mit wenig Austausch, die über wohldefinierte Schnittstellen zusammenarbeiten. Dieser Ansatz negiert jedoch zwei wichtige Aspekte. Zum einen ist Softwareentwicklung ein hochkollaborativer Prozess, der von ständigem Feedback und unvorhergesehenem Wissensaustausch lebt. Teams, die in Silos agieren, verlieren nicht nur Kontext, sondern auch die Möglichkeit, frühzeitig auf Änderungen in Anforderungen oder Technologie zu reagieren. Zum anderen unterliegt die optimale Architektur einem Wandel, der sich nur durch iterative Zusammenarbeit und ständigen Dialog zwischen Beteiligten sinnvoll gestalten lässt.
Die Idee, Kommunikation auf ein Minimum zu reduzieren, basiert zudem auf der problematischen Vorstellung der sogenannten „Cognitive Load“ – der mentalen Belastung einzelner Teams. Laut Team Topologies sollen Teams vor zu viel Komplexität und Informationsüberfluss geschützt werden, um effizient arbeiten zu können. Doch diese Argumentation ist paternalistisch und unterschätzt die Kompetenz und Eigenverantwortung von Fachkräften. Teams sind in der Lage, relevante Informationen auszuwählen und sich kontextuell einzuordnen, solange ein offener Dialog und geeignete Kommunikationswerkzeuge vorhanden sind. Dass die „Reduzierung von unnötiger Kommunikation“ in der Realität zu einer künstlichen Organisationszerlegung und Vereinsamung der Teams führt, hat fatale Folgen.
Es entstehen Kommunikationsbarrieren, die Innovationsfähigkeit sinkt und die Geschwindigkeit, mit der Probleme erkannt und gelöst werden, vermindert sich erheblich. Was als Optimierung verkauft wird, mutiert schnell zu ineffizienter Bürokratie, da für jede koordinierende Maßnahme neuer Aufwand entsteht und informelle Absprachen fehlen. Aus historischer und praktischer Perspektive zeigt sich, dass agile und DevOps-Methoden genau das Gegenteil anstreben. Sie fördern die Überwindung von Barrieren zwischen Teams und Abteilungen, um durch kontinuierliches Feedback und gemeinsame Verantwortung bessere Ergebnisse zu erzielen. Die bewusste Isolierung und Einschränkung der Kommunikation steht diesen Prinzipien diametral entgegen.
Ein weiterer Schwachpunkt von Team Topologies ist die strikte Zweiteilung der Architekturstile in Monolithen und Microservices. Zwar sind diese in der Praxis weit verbreitet, doch die Architektur eines Softwaresystems ist deutlich vielfältiger und komplexer. In modernen Anwendungen koexistieren verschiedene Architekturstile, Layer und Schnittstellen, die sich der vereinfachten Dichotomie entziehen. Auch die Annahme, dass Microservices grundsätzlich überlegen seien, ist eine Übervereinfachung. Microservices bringen trotz ihrer Vorteile auch neue Herausforderungen mit sich – etwa bei der Transaktionskonsistenz, der Infrastruktur und dem Betrieb.
Sie sind nicht per se besser, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll. Die Beschränkung auf diese Extrempole führt zu einer Blaupause, die für viele Organisationen schlicht nicht passt. Sie ignoriert die individuelle Domäne, die technologische Ausgangslage, die vorhandenen Kompetenzen und die reale Nutzungssituation. Somit verfehlt Team Topologies den Anspruch, eine universell anwendbare Lösung zu sein. Zudem fällt auf, dass Team Topologies stark von der sogenannten Spotify-Organisation inspiriert ist.
Diese sogenannte „Spotify Model“ wurde oft als Paradebeispiel für agile Skalierung genannt. Doch auch diese Herangehensweise entstand eher aus pragmatischen Notwendigkeiten eines schnellen Wachstums („Hyper Scaling“) als aus einer strategischen Überlegenheit. Für mittelgroße und etablierte Unternehmen ist dieses Modell häufig weder sinnvoll noch praktikabel und kann zu unnötigen Reibungsverlusten führen. Ein Kernkritikpunkt ist die Vernachlässigung von Erfahrungswissen und die Überhöhung formaler organisatorischer Maßnahmen. Organisationen sind komplexe soziale Systeme, in denen Vertrauen, individuelle Kompetenz und flexible Interaktion wichtig sind.
Der Versuch, alles über Strukturen, Teamgrößen oder physische Distanzierung zu steuern, untergräbt das psychologische Sicherheitsgefühl, die Kreativität und die Eigeninitiative der Mitarbeiter. Aus der Sicht moderner Organisationsentwicklung ist deshalb ein viel flexiblerer und empathischer Umgang mit Teamstrukturen notwendig. Anstatt „Top-Down“ über starre Grenzen zu verfügen, sollten Organisationen auf selbstorganisierte Teams, offene Kommunikationskanäle und adaptive Prozesse setzen. Die Fähigkeit, sich kontinuierlich an veränderte Anforderungen anzupassen, steht über statischen Designs. Im Kern zeigt die kritische Analyse von Team Topologies, dass reine Organisationsmodelle allein nicht ausreichen, um optimale Softwarearchitekturen oder effiziente Entwicklung zu gewährleisten.
Stattdessen sind kontextbezogene Ansätze gefragt, die Kommunikation fördern und die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Die Technologiebranche hat keinen Mangel an Modellen, sondern an praktikabler Umsetzung und echtem Verständnis für die oft widersprüchlichen Anforderungen von Teams, Kunden und Unternehmen. Eine pauschale Empfehlung, Kommunikation zu begrenzen oder Teams künstlich zu fragmentieren, stößt an natürliche Grenzen und kann schaden. In der Praxis empfiehlt es sich daher, Teamstrukturen dynamisch zu gestalten und den tatsächlichen Kommunikationsbedarf zu evaluieren. Agile Retrospektiven, regelmäßiger Austausch und kulturelle Offenheit sind hier die Schlüssel.