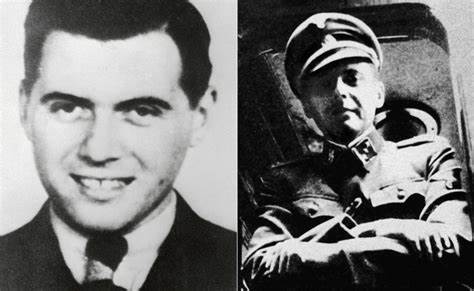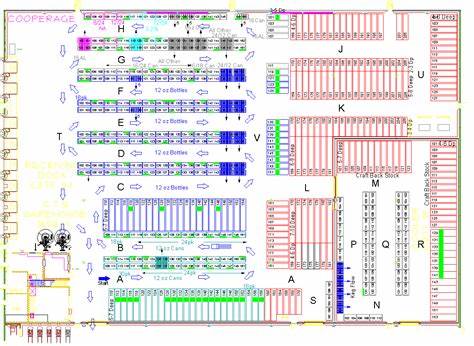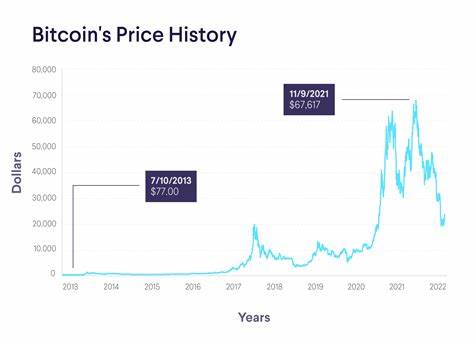Sigmund Rascher war eine der düstersten Figuren unter den Medizinern des Nationalsozialismus, dessen Karriere in den Todeslagern des Dritten Reiches mit einer bitteren Ironie endete. Rascher war als SS-Arzt und Mitglied der Luftwaffe tätig und leitete grausame Experimente auf dem Gelände des Konzentrationslagers Dachau. Seine Arbeiten waren geprägt von rigoroser Wissenschaftlichkeit, jedoch ohne jeglichen Respekt vor dem Leben der Opfer. Er war verantwortlich für sogenannte Gefrier- und Höhenexperimente, bei denen zahlreiche Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen sterben mussten. Trotz seiner Stellung in der SS und der Nähe zu hochrangigen NS-Funktionären war Rascher keiner Gnade sicher – er wurde kurz vor der Befreiung des Lagers von einem SS-Gericht zum Tode verurteilt und im selben Konzentrationslager erschossen.
Rascher begann seine menschenverachtenden Studien im Jahr 1939, als er aus eigenem Antrieb Heinrich Himmler anschrieb und um Häftlinge für medizinische Experimente bat. Anfangs beschäftigte er sich mit der Erforschung eines Pflanzenextrakts gegen Krebs, doch bald galt sein Interesse tödlicheren Themen. Das Konzentrationslager Dachau wurde zum Schauplatz seiner sogenannten wissenschaftlichen Untersuchungen über die Auswirkungen extremer Kälte und Höhen auf den menschlichen Organismus. Dabei unterschieden seine Versuche sich nicht grundlegend von den Verbrechen anderer Nazi-Mediziner – die Häftlinge wurden entmenschlicht, leiden gelassen und häufig zu Tode gefoltert. Die grausamen Gefrierexperimente zählten zu Raschers berüchtigtsten Qualen.
Die Opfer wurden in Eisbäder getaucht, um den Kältestress auf ihren Körper zu messen. Ziel war es, den Prozess der Unterkühlung und anschließend des Wiedererwärmens möglichst präzise zu dokumentieren. Die Opfer, zumeist politische Gefangene, wurden nicht nur dem Tod ausgesetzt, sondern mussten oftmals stundenlange Qualen erleben. Augenzeugenberichte zeugen von besonders furchtbaren Szenen, bei denen Häftlinge erbärmlich schrien, ihre Muskeln krampften und ihr Herz versagte. Trotz der tödlichen Folgen für viele der Versuchspersonen waren diese Experimente keine bloßen Willkürakte, sondern durchdrungen von einem pseudomedizinischen Anspruch.
Die Gründe für Raschers gnadenlose Haltung liegen teilweise in seiner ideologischen Verblendung und seiner Einstellung gegenüber den Opfern. In seinen Briefen an Himmler äußerte er deutlich, dass es sich bei den Versuchsobjekten um minderwertige Menschen handele, vor allem polnische und russische Gefangene, denen keinerlei Sonderbehandlung zustehe. Selbst Himmler intervenierte hin und wieder, indem er beispielsweise vorschlug, Überlebende der Höhenexperimente mit lebenslanger Haft zu strafen statt mit dem Tod, doch Rascher lehnte entschieden ab. Er betrachtete seine Opfer als entbehrlich und unwert. Neben den Gefrier- und Höhenversuchen war Rascher auch an der Entwicklung von Blutgerinnungsmitteln interessiert, die auf natürliche Pektine aus Roter Bete und Äpfeln basierten.
Diese sogenannten Polygal-Substanzen sollten auf dem Schlachtfeld Blutungen stillen und Soldaten retten. Doch auch hier führte Rascher seine Studien mit menschlichen Versuchspersonen durch – letztlich wurden mehrere Gefangene nach der Verabreichung dieser Substanzen hingerichtet und obduziert, um deren Wirkung zu beurteilen. Sein Mangel an Mitgefühl und wissenschaftliches Interesse wurden weder durch die hierzulande üblichen ethischen Maßstäbe noch durch den elementarsten Anstand gebremst. Rascher war bei hohen Stellen innerhalb der SS beliebt. Dies lag neben seiner Rolle als Wissenschaftler auch an seinen familiären Verbindungen.
Seine Ehefrau Karoline „Nini“ Diehl war nicht nur eine Sängerin, sondern auch offenbar eine Vertraute Himmlers. Diese persönliche Beziehung verschaffte Rascher außergewöhnliche Privilegien, seine Familie wurde durch Himmler unterstützt und sogar als idealtypischer SS-Familienverbund propagiert. Dabei wurde bald bekannt, dass die Kinder des Paares nicht biologisch von ihnen stammten, sondern entführte Kinder aus anderen Familien waren. Nach dem Bekanntwerden dieser Verbrechen wurde gegen Rascher und seine Frau ermittelt und beide festgenommen. Die Verhaftung Raschers erfolgte nicht aufgrund moralischer Einsicht des Regimes, sondern weil er sich durch seine kriminellen Machenschaften und Untaten bei hochrangigen NS-Funktionären unbeliebt gemacht hatte.
Insbesondere die Kidnapping-Affäre war ein Skandal, der Himmler zutiefst enttäuschte. Rascher wurde als Verräter eingestuft und verlor rasch seinen Einfluss. Er wurde von der SS degradiert und 1944 nach Buchenwald deportiert, wo er selbst zum Gefangenen wurde. Seine einstige Macht wandelte sich zu einem Schicksal in Gefangenschaft und Isolation. Wenige Monate vor der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau im Frühjahr 1945 wurde Rascher verlegt und dort auf Befehl Himmlers standrechtlich erschossen.
Die Hinrichtung an jenem Ort, an dem er zahllose Menschen gequält und getötet hatte, stellt eine bitter-ironische Wendung seines Lebens dar. Zeitzeugen berichten, dass der Offizier, der die Erschießung ausführte, Rascher verspottete und ihn als „Schwein“ beschimpfte. Raschers Frau wurde ebenfalls auf Anweisung Himmlers getötet. Die Nachwirkung von Raschers medizinischen Experimenten ist bis heute ein schwieriges Thema. Seine wissenschaftlichen Dokumentationen, insbesondere zu den Folgen von Unterkühlung, wurden bis in die späten 1980er Jahre als valide Forschungsergebnisse zitiert, obwohl sie auf grausamen Menschenversuchen basierten und letztlich unzuverlässig waren.
Diese Tatsache wirft ein Schlaglicht auf das Spannungsfeld zwischen verantwortungsloser Wissenschaft und ethischer Verpflichtung. Raschers Lebensweg ist ein mahnendes Beispiel für die Verstrickung von Medizin und Ideologie im Nationalsozialismus. Er personifiziert den Missbrauch von Wissenschaft zur Rechtfertigung von Gewalt und Erniedrigung. Seine Hinrichtung im selben Konzentrationslager, in dem er unzählige Opfer fand, symbolisiert das letztlich fatale Ende eines Mannes, der selbst zum Gefangenen seines Systems wurde. Neben ihm haben viele andere Mediziner des NS-Regimes schwere Verbrechen begangen, doch kaum einer wurde so präzise verurteilt und fand sein Ende in jenem Ort, den er zur Vernichtung missbraucht hatte.
Die Aufarbeitung der Verbrechen Sigmund Raschers ist Teil der umfassenderen Erinnerungskultur an die Schreckensherrschaft der Nazis. Sie erinnert an die Notwendigkeit, Wissenschaft und Ethik niemals voneinander zu trennen und die Menschenwürde in den Mittelpunkt medizinischer Forschung zu stellen. Nur so können zukünftige Generationen die Abgründe verstehen, die entstehen, wenn Wissenschaft zur Waffe der Grausamkeit wird.