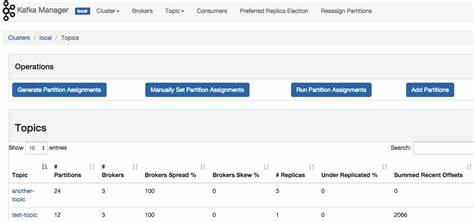Die Sahara, heute bekannt als die größte heiße Wüste der Erde, war vor etwa 14.500 bis 5.000 Jahren während des sogenannten Afrikanischen Feuchtigkeitsintervalls (African Humid Period, AHP) eine grüne Savanne mit reichlich Wasser und einer vielfältigen Flora und Fauna. Dies ermöglichte nicht nur die Ansiedlung von Menschen, sondern auch die Ausbreitung der Viehzucht. Trotz der Bedeutung dieser Epoche gab es lange Zeit kaum genetische Daten, die das Bevölkerungs- und Migrationsgeschehen im Zentralen Sahara-Gebiet beleuchten konnten – einer Region, in der DNA aufgrund der heutigen klimatischen Bedingungen nur schwer erhalten bleibt.
Jüngste Forschungen haben nun anhand von antiker DNA, gewonnen aus zwei ungefähr 7.000 Jahre alten weiblichen Individuen, die in der Takarkori-Felsenschutzhütte im Südwesten Libyens gefunden wurden, bahnbrechende Erkenntnisse geliefert.Diese DNA-Analysen zeigen, dass der Großteil der genetischen Herkunft dieser Takarkori-Individuen von einer zuvor unbekannten nordafrikanischen Linie stammt, die sich zeitgleich mit frühen menschlichen Außen-Afrikanischen Linien von jenen der subsaharischen Afrikaner getrennt hat. Diese genetische Gruppe blieb über die Jahrtausende weitgehend isoliert. Besonders interessant ist die enge Verwandtschaft der Takarkori-Genetik mit jener von vor 15.
000 Jahren datierten Jägern aus der Taforalt-Höhle im marokkanischen Rif-Gebirge, die der Iberomaurusischen Kultur zugeordnet werden und somit noch vor dem Beginn des Afrikanischen Feuchtigkeitsintervalls lebten. Sowohl die Takarkori- als auch die Taforalt-Menschen zeigen eine ähnliche Distanz zu den subsaharischen Populationen, was darauf hindeutet, dass es während des AHP nur sehr begrenzte genetische Vermischungen zwischen den Populationen Nord- und Subsahara-Afrikas gab.Ein besonders bemerkenswertes Ergebnis ist der Nachweis von Neandertaler-Anteilen im Genom der Takarkori-Frauen. Interessanterweise sind diese Anteile zehnmal kleiner als bei neolithischen Bauern aus dem Nahen Osten, aber dennoch deutlich höher als bei heutigen und antiken subsaharischen Afrikanern. Diese Daten legen nahe, dass die Takarkori-Population aus einer tief divergenten nordafrikanischen Linie stammt, welche während des Pleistozäns weit verbreitet war und wenig genetischen Kontakt zu anderen Populationen hatte.
Die Verbreitung der Viehzucht in der Sahara könnte demnach weniger auf massive Wanderungsbewegungen basieren, sondern vielmehr auf kultureller Diffusion zwischen den Gruppen zurückzuführen sein.Die archäologischen Untersuchungen in der Takarkori-Felsenschutzhütte bestätigen, dass diese Gegend während des Afrikanischen Feuchtigkeitsintervalls eine bedeutende Siedlungsstelle bildete. Es wurden 15 menschliche Bestattungen aus der Zeit zwischen etwa 8.900 und 4.800 Jahren vor heute ausgegraben, darunter die beiden untersuchten Frauen.
Die Fundstätte liefert damit ein unvergleichlich reichhaltiges Material zum sozialen und wirtschaftlichen Wandel jener Zeit. Besonders auffällig ist, dass die Bestattungen überwiegend Frauen und Kinder betreffen, was möglicherweise auf soziale Strukturen oder spezifische Bestattungssitten hinweist. Isotopenanalysen belegen zudem, dass die Individuen überwiegend eine lokale Herkunft hatten.Die gewonnenen genetischen Daten wurden mittels moderner Methoden analysiert, darunter die Extraktion von DNA aus Zähnen und Knochenfragmenten, sowie das selektive Anreichern bestimmter genetischer Marker. Trotz der fragilen Beschaffenheit der DNA konnten über 800.
000 genetische Positionen bei einem Individuum ausgewertet werden, während das andere zwar eine geringere Datendichte aufwies, jedoch ebenso wertvolle Informationen lieferte. Vergleiche mit heutigen und alten Populationen Afrikas, Europas und des Nahen Ostens zeigten, dass die Takarkori-Menschen in der Populationen-Karte eine einzigartige Zwischenposition einnehmen, wobei sie enger mit nordwestafrikanischen Jägern verwandt sind als mit anderen Gruppen.Die Analyse der mitochondrialen DNA, welche nur über die mütterliche Linie vererbt wird, ordnet die Takarkori-Genome einem basalen Ast der sogenannten Haplogruppe N zu. Diese Linie hat eine geschätzte Altersspanne von über 60.000 Jahren und gilt als eine der ältesten nicht-sub-saharischen mitochondrialen Abstammungslinien.
Solche Erkenntnisse bestätigen, dass diese Populationen in Nordafrika bereits seit langer Zeit eigenständig existierten und genetisch von sowohl sub-saharischen als auch außen-afrikanischen Populationen unterschieden waren.Vergleichsstudien mit den vorigen Modellen, die die Herkunft der Taforalt-Menschen als Mischung aus natufischer (Levant) und unspezifisch subsaharischer Abstammung interpretierten, zeigen nun, dass die subsaharische Komponente besser durch die Takarkori-ähnliche Linie aus der Zentral-Sahara repräsentiert wird. Das weist auf eine komplexe innerafrikanische Genese nordafrikanischer Populationen hin, die nicht primär von südlichen Gruppen abstammten.Darüber hinaus ermöglicht die Analyse der Neandertaler-DNA-Anteile neue Einsichten in die Verbindungen zwischen afrikanischen und außereuropäischen Populationen. Während die genetischen Spuren von Neandertalern in den meisten außereuropäischen Menschen nachweisbar sind, fehlen sie größtenteils in afrikanischen Gruppen.
Die Tatsache, dass Takarkori immerhin geringe, aber messbare Neandertaler-Abschnitte besitzt, spricht für einen gewissen, möglicherweise sehr alten genetischen Austausch oder für den Erhalt eines Ur-Anteils von Out-of-Africa-Abstammungen in Nordafrika.Die Entdeckung dieser uralten genetischen Signatur hat weitreichende Implikationen für unser Verständnis menschlicher Migrationen, kultureller Entwicklungen und der Entstehung landwirtschaftlicher Praktiken in Afrika. Die Verbreitung der Viehzucht in der Sahara, welche die Lebensweise der Bewohner dieser Region nachhaltig veränderte, scheint weniger das Ergebnis invasiver Bevölkerungsbewegungen gewesen zu sein, sondern vielmehr der langsamen Übernahme neuer Technologien und sozioökonomischer Strukturen über kulturellen Austausch. Dies steht im Einklang mit archäologischen Befunden, die Veränderungen in Materialkultur und Bestattungsriten über längere Zeiträume dokumentieren und einen graduellen Übergang anzeigen.Die ökologischen Bedingungen der Grünen Sahara stärkten vermutlich das Überleben und die regionale Isolation dieser genetischen Linie.
Trotz eines vergleichsweise lebensfreundlichen Klimas könnte das große Ausmaß der Sahara mit vielfältigen Ökosystemen tiefgreifende Barrieren zwischen Siedlungsgebieten erzeugt haben. Diese landschaftlichen Hindernisse schränkten die genetische Durchmischung über größere Strecken hinweg ebenfalls ein. Zusammen mit sozialen und kulturellen Faktoren trug dies zur Entstehung klar definierter und stabiler Bevölkerungsstrukturen bei, was sich sowohl in der antiken als auch in der aktuellen genetischen Vielfalt Afrikas niederschlägt.Die Takarkori-Funde markieren somit einen ersten bedeutenden Schritt in der Erforschung der grünen Sahara und ihrer einstigen Bewohner. Zukünftige Untersuchungen könnten, unterstützt durch sinkende Sequenzierungskosten und verbesserte technische Verfahren, weitere Details zur Migrationsgeschichte und genetischen Landschaft dieses faszinierenden Abschnitts menschlicher Geschichte enthüllen.