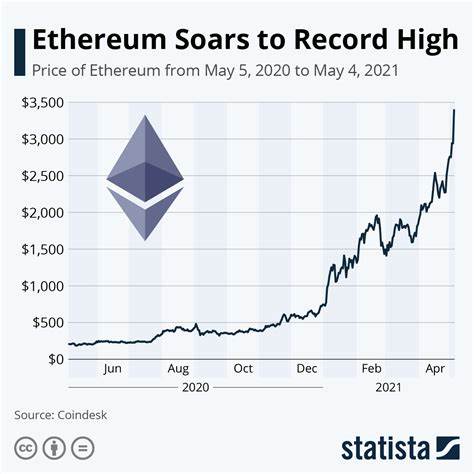In den letzten Jahren ist das Thema elektronische Überwachung und Datenbanken im Zusammenhang mit Kriminalitätsbekämpfung zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Besonders besorgniserregend ist dabei die Existenz einer Gang-Datenbank, die seit zwei Jahrzehnten von der New Yorker Staatspolizei betrieben wird. Diese Datenbank enthält aktuell mehr als 5.100 Personen, die als vermeintliche Mitglieder krimineller Banden eingestuft sind und deren Informationen an Bundesbehörden wie das US-amerikanische Immigrations- und Zollbehörde ICE weitergeleitet werden. Die Hintergründe, Funktionsweise und Auswirkungen dieser Gang-Datenbank werfen ein Schlaglicht auf die Entwicklung polizeilicher Überwachungsmaßnahmen, rechtliche Grauzonen und gesellschaftliche Diskussionen über Rassismus und Bürgerrechte.
Die Gang-Datenbank der New Yorker Staatspolizei existiert bereits seit 20 Jahren und wird vom New York State Intelligence Center (NYSIC) verwaltet – einem Fusion Center, das nach den Anschlägen vom 11. September 2001 zur Förderung des Informationsaustauschs zwischen lokalen, staatlichen und Bundesbehörden eingerichtet wurde. Trotz ihrer Bedeutung blieb die Datenbank über Jahre hinweg weitgehend unbekannt und wurde kaum von außen überprüft oder hinterfragt. Laut offiziellen Angaben umfasst die Datenbank über 225 mutmaßliche kriminelle Gruppen und bietet Polizeibeamten die Möglichkeit, Personen anhand verschiedener Kriterien als Gang-Mitglieder zu kennzeichnen. Die Kriterien für die Aufnahme in die Datenbank sind besonders problematisch.
Es werden unter anderem Verhaltensmuster wie der Aufenthaltsort, Social Circles, Kleidungsstil, Tätowierungen oder Handzeichen herangezogen. Viele dieser Merkmale sind jedoch äußerst spekulativ und erlauben keine eindeutigen Rückschlüsse auf kriminelle Aktivitäten. Außerdem können Einträge durch Angaben von Informanten, deren Zuverlässigkeit oft unklar ist, ergänzt werden. Es genügt, wenn zwei der Kriterien erfüllt sind, um jemanden in den Datenbestand aufzunehmen. Oft betreffen diese Faktoren vor allem junge Männer aus ethnischen Minderheiten, insbesondere Schwarze und Hispanics, die so einem starken Überwachungsdruck ausgesetzt sind.
Die Staatspolizei selbst gibt jedoch keine Aufschlüsselung der Einträge nach ethnischer Zugehörigkeit heraus. Die Tatsache, dass die Staatsdatenbank ihre Informationen an ICE weitergibt, macht die Sache besonders brisant. ICE verwendet diese Angaben für die Abschiebung von Einwanderern, die als Gang-Mitglieder stigmatisiert werden, häufig ohne dass diese bei Gericht angeklagt oder verurteilt wurden. Die Trump-Administration nutzte solche Daten, um eine rigide Abschiebungspolitik durchzusetzen, bei der unter anderem Männer in das berüchtigte CECOT-Gefängnis in El Salvador geschickt wurden, das für seine menschenunwürdigen Zustände bekannt ist. Dabei werden oftmals zweifelhafte Indizien wie bestimmte Tätowierungen oder Kleidungsstücke als Beweis angeführt, zum Beispiel das Tragen von Sportlogos, die nach Einschätzung von Polizei und Behörden als Zeichen der Gangzugehörigkeit interpretiert werden.
Experten und Betroffene weisen diese Beobachtungen als willkürlich und diskriminierend zurück. Die Gang-Datenbank wird von verschiedenen Strafverfolgungsbehörden in New York gefüttert. Jegliche Polizeieinheit kann Namen ergänzen, und dies geschieht regelmäßig: Jährlich werden mehrere hundert neue Personen eingetragen. Neben der New Yorker Staatspolizei betreiben auch das NYPD eine eigene Gang-Datenbank mit größeren Ausmaßen, deren Kritikpunkte ähnlich gelagert sind. Während es intensive öffentliche Debatten und Gesetzesvorschläge gibt, die die Abschaffung oder Reform dieser Datenbanken beim NYPD fordern, ist die staatliche Gang-Datenbank weniger bekannt und weniger kontrovers diskutiert.
Das liegt auch daran, dass die Staatspolizei diese Daten sprichwörtlich unter Verschluss hält und in offiziellen Berichten nur mit dem Kürzel GRIP (Gang Reporting and Intelligence Program) erwähnt. Die neuesten Erweiterungen der Datenbank umfassen auch eine intensive Auswertung öffentlich zugänglicher Social-Media-Aktivitäten. Seit einigen Jahren werden Millionen Dollar investiert, um moderne Überwachungstechnologien einzusetzen, die unter anderem schulische Gewalt, Gangaktivitäten und Waffenhandel über soziale Netzwerke besser beobachten sollen. Kritiker befürchten dadurch eine noch stärkere Überwachung und Stigmatisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen, während die Risiken für Fehler, Missbrauch und unfaire Behandlung steigen. Die Konsequenzen für Personen, die in die Gang-Datenbank eingetragen werden, sind gravierend.
Da eine Überprüfung oder Korrektur der Einträge kaum möglich ist, befinden sich in der Datenbank oft Menschen, die keine Straftaten begangen haben oder deren mutmaßliche Beteiligung an Gangs nicht nachweisbar ist. Die Folge sind verstärkte polizeiliche Kontrollen, länger dauernde Ermittlungen oder erschwerte Bedingungen in Gerichtsverfahren, die in sogenannten „Gang Enhancement“-Anklagen münden können. Diese Verschärfung der Strafen basiert manchmal lediglich auf dem Eintrag in der Datenbank, was rechtliche Ungleichheiten verstärkt. Darüber hinaus erzeugt die Datenbank eine Dynamik, die bereits bestehende Ungleichheiten und Vorurteile verstärkt. Studien zeigen immer wieder, dass Gang-Datenbanken überwiegend junge Männer aus marginalisierten ethnischen Gruppen listen, während andere Bevölkerungsgruppen seltener betroffen sind.
Die Spekulationen rund um Kleidungsstücke, Tattoos oder Aufenthaltsorte erzeugen einen Teufelskreis, der fatale Auswirkungen auf die schwer zu rehabilitierende Stigmatisierung von Betroffenen mit sich bringt. Ein besonderes Problem stellt die fehlende externe Kontrolle dar. Die staatliche Gang-Datenbank ist bislang nicht auditert worden. Transparenz über Auswahlprozesse, Einsichts- und Korrekturmöglichkeiten für Betroffene oder Maßnahmen gegen diskriminierende Praktiken fehlen weitgehend. Dies schafft einen rechtlichen Graubereich, der umso brisanter ist, da die Daten an Bundesbehörden und auch an private Firmen wie Palantir weitergegeben werden.
Palantir, eine Datenanalysefirma mit engen Verbindungen zur Regierung, hat die Software entwickelt, die ICE nutzt, um Daten für Ermittlungen in Sekundenschnelle verfügbar zu machen. Dieses Zusammenspiel von staatlicher Überwachung und privater Datenverarbeitung wirft grundsätzliche Fragen zum Datenschutz und zu Bürgerrechten auf. Politisch befindet sich die Situation in New York in einem Geflecht widersprüchlicher Signale. Die Gouverneurin Kathy Hochul hat einerseits versprochen, gegen die Massenabschiebungen der Trump-Administration vorzugehen und die Rechte der Einwanderer zu schützen. Andererseits investiert ihre Regierung weiterhin massiv in die Ausweitung von Überwachungs- und Polizeikapazitäten, einschließlich der Gang-Datenbanken.
Während Hochul offiziell erklärt, dass die New Yorker Staatspolizei nicht mit ICE kooperieren werde, läuft der Informationsfluss gerade von der staatlichen Gang-Datenbank zu ICE seit Jahrzehnten kontinuierlich weiter. Der politische Diskurs in New York City zeigt ebenfalls Spannungen. Auf kommunaler Ebene wird intensiv über die Abschaffung der Gang-Datenbank des NYPD diskutiert, um rassistische Polizeipraktiken zu bekämpfen und Überwachung einzudämmen. Die staatliche Gang-Datenbank bleibt dabei im Schatten, obwohl ihre Wirkungen ähnlich einschneidend sind. Aktivisten und Experten fordern eine umfassende Reform aller Gang-Datenbanken, mehr Transparenz sowie wirksamen Schutz der Privatsphäre und Rechte der Betroffenen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gang-Datenbank der New Yorker Staatspolizei eine zentrale Rolle in der heutigen Sicherheitsarchitektur einnimmt, gleichzeitig aber erhebliche Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringt. Der Gebrauch spekulativer Kriterien und das Fehlen notwendiger Kontrollen führen dazu, dass viele Menschen zu Unrecht überwacht, stigmatisiert und in ihrem Leben beeinträchtigt werden. Die Weitergabe der Daten an Bundesbehörden wie ICE öffnet zudem den Raum für mögliche Menschenrechtsverletzungen und missbräuchliche Abschiebungen. Die Debatte um die Datenbank verweist auf grundsätzliche Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen öffentlicher Sicherheit, Datenschutz und Gerechtigkeit, die nicht nur in New York, sondern weltweit an Bedeutung gewinnen. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Gang-Datenbank, verbunden mit stärkerem politischen und gesellschaftlichen Engagement, erscheint dringend notwendig, um den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen persönlichen Informationen sicherzustellen.
Erweiterte Transparenz, unabhängige Aufsicht und die Anerkennung der Rechte Betroffener sind Voraussetzungen, damit Sicherheit nicht auf Kosten von Freiheit und Gleichbehandlung erkauft wird. Die Diskussion um die Gang-Datenbanken dient damit als Beispiel für die breitere Spannung zwischen moderner Technologie, Überwachung und demokratischen Grundwerten im 21. Jahrhundert.