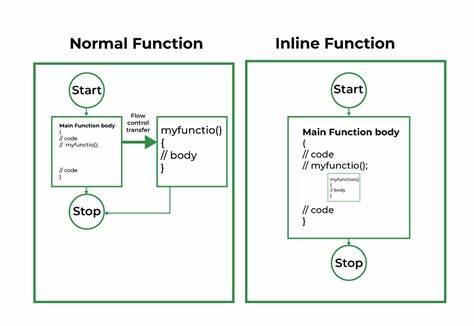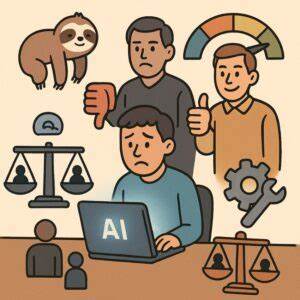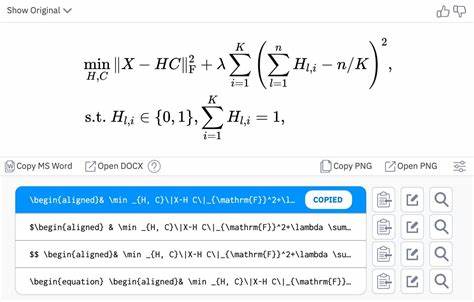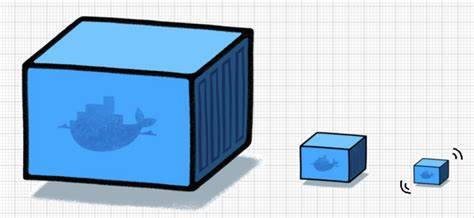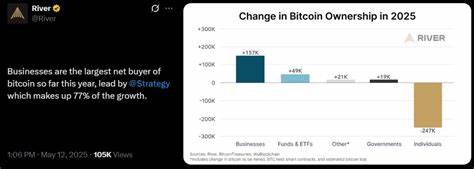Der chinesische Smartphone-Markt erlebt derzeit eine tiefgreifende Umwälzung, bei der die Dominanz internationaler Marken, allen voran Apple, stark ins Wanken gerät. Im März 2025 sind die iPhone-Auslieferungen in China im Vergleich zum Vorjahr um nahezu 50 Prozent eingebrochen. Dies ist ein beachtlicher Rückschlag für Apple in einem der wichtigsten Smartphone-Märkte weltweit. Währenddessen gewinnen lokale Hersteller wie Huawei, Vivo, Xiaomi und Oppo erheblich an Boden und beherrschen inzwischen etwa 92 % des chinesischen Smartphone-Marktes. Diese Entwicklung markiert eine deutliche Trendumkehr und wirft grundlegende Fragen über die Zukunft internationaler Marken in China auf.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die iPhone-Auslieferungen fielen innerhalb eines Jahres von 3,75 Millionen auf nur noch 1,89 Millionen Geräte. Dies mindert Apples Anteil am chinesischen Smartphone-Markt auf ungefähr 8 %, während die heimischen Anbieter ihren Marktanteil weiter ausbauen konnten. Im Gegensatz dazu verzeichnet der Gesamtmarkt in China trotz dieses Einbruchs bei Apple ein Wachstum von etwa 3,3 % im gleichen Zeitraum. Besonders auffällig ist zudem, dass der Absatz von Nicht-Chinesischen Marken insgesamt um über 25 % zurückging, was die Verschiebung hin zu lokalen Produkten zusätzlich unterstreicht.Schon seit längerer Zeit setzen die führenden chinesischen Hersteller verstärkt auf eigene Technologien, Innovationen und maßgeschneiderte Softwarelösungen, um sich im Wettbewerb zu behaupten.
Huawei, das mittlerweile aufüber 19 % Marktanteil kommt, hat sich mit der Entwicklung eigener Chips und dem Betriebssystem HarmonyOS Next eine wichtige Unabhängigkeit von westlichen Anbietern verschafft. Diese technologische Unabhängigkeit ist für die Verbraucher in China ein starkes Signal. Gerade in einer Zeit, in der Spannungen zwischen China und den USA im Technologie-Sektor zunehmen, erscheint der Kauf eines „made in China“-Smartphones als strategische Entscheidung und fördert die Loyalität gegenüber einheimischen Marken.Die chinesische Regierung trägt durch verschiedene politische Maßnahmen und Anreize ebenfalls zur Dominanz lokaler Unternehmen bei. So werden beispielsweise Kaufanreize durch staatliche Subventionen von bis zu 15 % auf Elektronikprodukte gewährt, sofern der Kaufpreis unter 6.
000 Yuan (etwa 820 US-Dollar) liegt. Apples iPhone 16 startet mit einem Basispreis von 5.999 Yuan und fällt somit gerade noch in diese Förderkategorie. Dennoch reicht dieser Nachlass offenbar nicht aus, um die Preissensibilität vieler chinesischer Konsumenten auszugleichen, die zunehmend preiswertere und technisch hochqualitative Alternativen lokal verfügbarer Marken bevorzugen.Darüber hinaus beeinflussen auch politische Faktoren das Kaufverhalten in China.
Die Regierung hat beispielsweise den Einsatz von iPhones in staatlichen Einrichtungen aus Sicherheitsbedenken verboten, wobei Befürchtungen über mögliche Hintertüren in iPhones, ähnlich den bereits bekannten Kontroversen über NSA-Überwachung, eine Rolle spielen. Ob diese Sorgen begründet sind oder Teil einer wechselseitigen politischen Eskalation, ist umstritten. Fest steht jedoch, dass dies das Image von Apple in China spürbar belastet. In einer Zeit, in der politisches Vertrauen eine immer größere Rolle bei Kaufentscheidungen spielt, fällt das Image eines ausländischen, insbesondere US-amerikanischen, Konzerns spürbar ab.Auch der Preis spielt eine entscheidende Rolle bei der Veränderung der Marktanteile.
Die Kunden in China sind zunehmend preissensitiv und bevorzugen erschwinglichere Smartphones, die technisch mit Apple-Geräten mithalten können. Lokale Marken bieten zudem häufig eine bessere Anpassung der Hardware an die Bedürfnisse und Vorlieben chinesischer Nutzer, etwa durch erweiterte Kamerafunktionen, längere Akkulaufzeit und eine stärkere Integration populärer chinesischer Apps und Dienste wie WeChat. Das erleichtert den Umstieg auf ein alternatives Gerät und verringert die Bindung an Apple-Produkte.Neben Huawei sticht auch Vivo mit einem Marktanteil von 17 %, Xiaomi mit 16,6 % und Oppo mit 14,6 % hervor. Diese Marken profitieren von ihrer starken Präsenz in den Regionen, umfangreichen Marketingstrategien und flexiblen Preismodellen.
Zudem setzen sie oft auf die neueste Technologie und designen Smartphones, die den Geschmack chinesischer Verbraucher genau treffen. Ihre Hardware ist oft mit chinesischen Betriebssystemen und Benutzeroberflächen optimiert, was den Wechsel von iOS zu Android-Varianten stark vereinfacht.Apples sinkender Marktanteil in China hat auch finanzielle Konsequenzen für den Konzern. China ist einer der lukrativsten Märkte für Smartphones weltweit, und ein Rückgang der Verkaufszahlen wirkt sich unmittelbar auf Apples Umsätze und Gewinnmargen aus. Diese Entwicklung zwingt Apple zu einer Neubewertung seiner Marktstrategie vor Ort.
Es ist denkbar, dass Apple künftig weitere Anstrengungen unternehmen muss, um für chinesische Verbraucher attraktiver zu werden. Denkbar sind unter anderem eine verstärkte Lokalisierung von Software und Dienstleistungen, Investitionen in preislich günstigere Modelle oder eine intensivere Zusammenarbeit mit heimischen Partnern.Ein weiterer Aspekt der sich wandelnden Dynamik ist die zunehmende Forderung nach Unabhängigkeit von globalen Diensten. Während Apple-Nutzer traditionell stark an das Ökosystem von iOS-Diensten gebunden sind, vertreten viele chinesische Benutzer zunehmend die Meinung, dass lokale Ökosysteme leistungsfähiger und sicherer sind. Dienste wie Alipay oder WeChat Pay dominieren den chinesischen Zahlungsverkehr und sind tief in lokale Apps und Plattformen integriert.
Die nahtlose Integration dieser Dienste in Android-Smartphones chinesischer Hersteller gibt diesen einen bedeutenden Vorteil, der von Apple nur schwer zu erreichen ist, speziell angesichts von regulatorischen Einschränkungen.Neben dem Wettbewerb auf technischer und politischer Ebene spielen auch kulturelle Faktoren eine Rolle. Verbraucher in China zeigen verstärkt ein Bewusstsein für die Unterstützung nationaler Unternehmen, mehr noch in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und Handelskonflikte. Das führt zu einer bewussten Kaufentscheidung zugunsten einheimischer Anbieter. Diese Marken haben außerdem den Vorteil, dass sie kulturell besser auf die Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Kunden eingehen können und oft schneller auf Trends und Veränderungen im Markt reagieren.