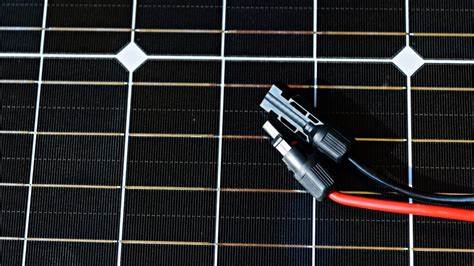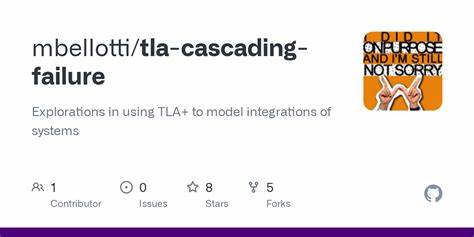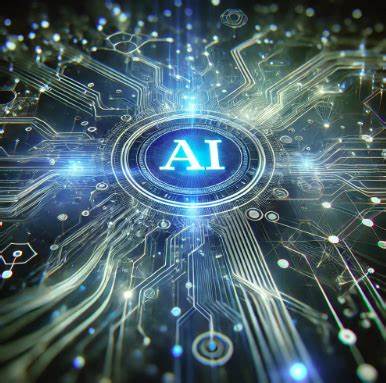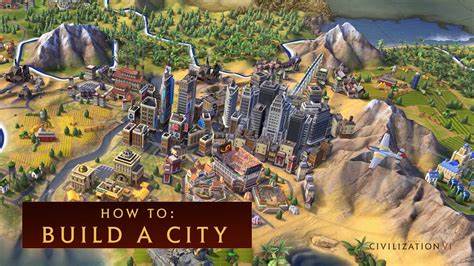Künstliche Intelligenz (KI) verändert unser Leben in einem rasanten Tempo. Diese Technologie bietet enorme Chancen, von schnelleren medizinischen Diagnosen bis hin zu effizienteren öffentlichen Dienstleistungen. Doch neben den Vorteilen existieren erhebliche Risiken. Deepfakes, Fehlinformationen, der Verlust von Arbeitsplätzen, der Missbrauch persönlicher Daten und Bedrohungen kritischer Infrastrukturen sind nur einige davon. Vor diesem Hintergrund wächst in der amerikanischen Bevölkerung der Wunsch nach klaren Regeln und effektiver Aufsicht.
Untersuchungen zeigen, dass eine überwältigende Mehrheit der US-Bürger für die Einrichtung einer speziellen Bundesbehörde zur Regulierung von KI ist. Gleichzeitig herrscht eine tiefe Skepsis gegenüber der Geschwindigkeit und Wirksamkeit, mit der Regierung und Gesetzgeber bisher auf diese Herausforderungen reagiert haben. Trotz dieser breiten öffentlichen Forderung nach Schutzmaßnahmen steht der US-Kongress aktuell vor einem Schritt, der das Gegenteil bewirken könnte: Ein letztes, stillschweigendes Moratorium, das den Bundesstaaten für ein Jahrzehnt verbietet, eigene Vorschriften zur Regulierung von KI zu erlassen. Dieses Gesetzesvorhaben ist Teil eines Bundeshaushaltsgesetzes und würde weitreichende Folgen für den zukünftigen Umgang mit KI nach sich ziehen. Es verbietet den Bundesstaaten, irgendein Rechts- oder Verwaltungsgesetz im Bereich von KI-Modellen, -Systemen oder automatisierten Entscheidungssystemen zu erlassen oder durchzusetzen.
Eine derartigen pauschale Einschränkung der Kompetenzen der Bundesstaaten wäre aus mehreren Gründen äußerst problematisch. Zum einen verstoßen solche Maßnahmen vermutlich gegen den 10. Verfassungszusatz der Vereinigten Staaten. Dieser besagt, dass Aufgaben und Zuständigkeiten, die nicht ausdrücklich an die Bundesregierung übertragen sind, bei den Bundesstaaten oder dem Volk verbleiben. Der Grundsatz der bundesstaatlichen Selbstverwaltung stellt ein zentrales Element der amerikanischen Demokratie dar.
Einen derart umfassenden Ausschluss von der Möglichkeit, auf KI-Risiken durch eigene Gesetze zu reagieren, gab es bisher in noch keinem Bereich vergleichbaren Ausmaßes. Dies trifft besonders dann zu, wenn man bedenkt, wie dynamisch und vielfältig die Herausforderungen sind, die KI heute bereits in Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeit und Bürgerrechten verursacht. Mehrere Bundesstaaten haben bereits proaktive Schritte unternommen, um ihre Bürger vor den negativen Auswirkungen von KI zu schützen. Twenty Staaten haben beispielsweise Gesetze gegen den Einsatz von Deepfakes in Wahlkampagnen verabschiedet, um die Integrität demokratischer Prozesse zu wahren. Colorado hat umfassende Richtlinien eingeführt, die Transparenz und Verantwortlichkeit bei KI-gestützten Entscheidungen garantieren sollen, von denen Verbraucher und Arbeitnehmer direkt betroffen sind.
Solche Initiativen setzen dem ungezügelten Einsatz von KI einen wirksamen Rahmen entgegen, den auf Bundesebene bislang niemand geschaffen hat. Die geplante bundesweite Gesetzesregelung würde nicht nur diese Fortschritte unterbinden, sondern auch wichtige Möglichkeiten zur Haftung von Unternehmen für Schäden blockieren. Einige Bundesstaaten wie Kalifornien haben etwa versucht, Wege zu finden, Firmen für katastrophale Schäden durch KI-Systeme zur Verantwortung zu ziehen – auch das wäre in Zukunft nicht mehr möglich. Befürworter eines bundesweiten Verbots argumentieren häufig mit der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der USA gegenüber China im Bereich KI zu sichern. Dabei wird eine einheitliche Regulierung oft als schnellere und effektivere Maßnahme dargestellt, um fragmentierte und widersprüchliche Bestimmungen auf Bundesstaatsebene zu vermeiden, die Innovationen behindern könnten.
Hierbei wird jedoch eine wichtige Unterscheidung übersehen. Die Realität ist derzeit weniger ein Kampf zwischen einer kohärenten Bundesgesetzgebung und einem Flickenteppich aus Landesgesetzen, sondern vielmehr ein Mangel an umfassenden bundesweiten Regelungen überhaupt. Die Bundesstaaten versuchen, die durch die Untätigkeit Washingtons entstandene Regulierungslücke zu schließen. Diese föderale Ohnmacht lässt Privatpersonen, Verbraucher und Arbeitnehmer schutzlos gegenüber den Risiken von KI-Technologien zurück. Daher zeigt sich, dass ein bundesweites Verbot der staatlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei KI einem Rückschritt gleichkommen würde, statt den Anforderungen der Zeit Rechnung zu tragen.
Zudem ist die Sorge, dass die USA im Wettbewerb mit China wegen einer zu strengen Regulierung zurückfallen könnten, nur bedingt berechtigt. Tatsächlich reguliert China den KI-Sektor deutlich umfangreicher als die USA, ohne dass dies ihr Fortschreiten entscheidend verlangsamt hätte. Die technologischen Entwicklungen in den USA und China sind vielmehr stark vergleichbar, wobei die Unternehmen beider Seiten ähnliche Modelle, Daten und Techniken nutzen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass eine moderate Regulierung amerikanischer KI-Unternehmen die globale Wettbewerbsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt. Die Befürworter solcher Vorhaben verkennen auch, dass viele US-amerikanische Tech-Giganten enorme finanzielle Mittel haben, um Kosten für regulatorische Maßnahmen zu stemmen.
Die potenziellen Ausgaben werden von diesen Firmen eher als betriebliche Kosten wahrgenommen und dürften keinen substantiellen Einfluss auf ihr Innovationspotenzial haben. Gleichzeitig wird die fundamentale Frage der Bundesstaatenrechte in der Debatte oft ignoriert. Ein solches autoritäres Vorgehen des Bundes, das uneingeschränkte Macht über Rechtsrahmen übernimmt, könnte einen bedrohlichen Präzedenzfall schaffen. Er steht im Gegensatz zu lang etablierten Checks and Balances und gefährdet das föderale Gleichgewicht, das nicht nur bei KI, sondern auch bei kontroversen Themen wie Abtreibung oder Waffenkontrolle von entscheidender Bedeutung ist. Verschiedene Politiker und Experten warnen deshalb vor einer „Dunkelzeit“ für den Schutz von Umwelt, Kindern und marginalisierten Gemeinschaften, sollte das Moratorium in Kraft treten.
Auch Verbraucherschützer beklagen, dass der Kongress seit Jahren seiner Aufgabe, angemessene Gesetze zu verabschieden, nicht nachkomme. In Zukunft würden dann auch die Bundesstaaten keine Möglichkeit mehr haben, auf neue Gefahren und Missstände zu reagieren. Die Entwicklung zeigt, dass viele Bundesstaaten nicht untätig geblieben sind. Mehr als 30 Staaten haben seit 2022 bereits Gesetze oder Resolutionen mit KI-Bezug verabschiedet. 2024 wurden allein in 31 Bundesstaaten einschlägige Bestimmungen zu KI erlassen.
Dabei reichen die Maßnahmen von der Einrichtung von Beratungsgremien und Auswirkungsstudien bis hin zu Förderprogrammen und umfassenden Transparenzpflichten. Diese Initiativen reflektieren das Bewusstsein der Verantwortlichen, dass nur ein engagiertes, differenziertes und anpassungsfähiges Vorgehen im föderalen System wirkungsvollen Schutz bieten kann. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Bundesgesetzgeber seit Jahren kaum Fortschritte erzielt hat, sind solche bundesstaatlichen Schritte von großer Bedeutung. Die Tatsache, dass große Technologieunternehmen und einflussreiche Investoren hinter verschlossenen Türen mit Nachdruck auf eine nationale Regulierung drängen, die den Bundesländern jede Handhabe aus der Hand nimmt, macht die Debatte besonders brisant. Mit der Abschaffung des föderalen Wettbewerbspotenzials zugunsten einer zentralisierten Kontrolle würde die Selbstregulierung der Industrie weiter gestärkt.
Diese hat jedoch bereits vielfach versagt, wenn es darum geht, den Schutz der Öffentlichkeit sicherzustellen und ethische Grundsätze durchzusetzen. Das Fehlen staatlicher Aufsicht öffnet darüber hinaus Tür und Tor für verstärkte Lobbyarbeit seitens der Konzerne, um eigene Interessen ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Konsequenzen durchzusetzen. Darüber hinaus hat sich in Umfragen gezeigt, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung den Wunsch nach wirksamer Kontrolle ausdrückt. Eine dauerhafte Regulierungspause würde diese Sorgen ignorieren und den Eindruck vermitteln, dass eine kleine Elite die Technologieentwicklung ohne Rücksicht auf demokratische Prinzipien dominieren will. Daher liegt die Verantwortung bei jedem Einzelnen, sich politisch zu engagieren und Druck auf seine Abgeordneten auszuüben, um diese gefährliche Entwicklung zu verhindern.
Die Debatte um KI und ihre Regulierung ist eines der zentralen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Sie fordert eine ausgewogene, gut durchdachte Politik, die Innovation mit Verantwortung verbindet und das föderale System ehrt. Ein völlig zentralisierter Ansatz, der Bundesstaaten von ihrem Recht ausschließt, eigene Regelungen zu schaffen, wäre nicht nur verfassungsrechtlich fragwürdig, sondern auch gesellschaftlich kontraproduktiv. Der Schutz der Verbraucher, die Bewahrung demokratischer Transparenz und die Wahrung der Rechte von Arbeitnehmern und besonders gefährdeten Gruppen sind ohne aktive Mitwirkung der Bundesländer nicht zu gewährleisten. Wer KI zukunftsfähig und sozial verträglich gestalten will, sollte auf Kooperation und Komplementarität setzen – nicht auf rigide Verbote, die Vielfalt und Innovation behindern.
Die Debatte ist noch lange nicht abgeschlossen. Doch eins ist klar: Die Zukunft von KI in den Vereinigten Staaten wird entscheidend davon abhängen, wie Bund und Länder ihre Kräfte bündeln und gemeinsam Regeln entwickeln, die sowohl technologischen Fortschritt ermöglichen als auch die Bevölkerung nachhaltig schützen.