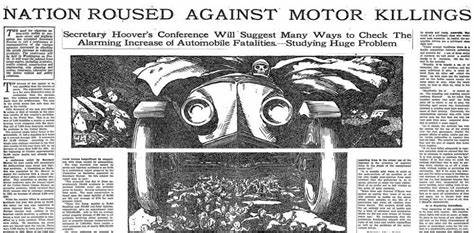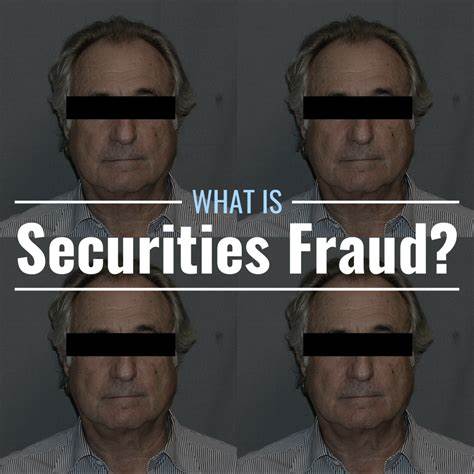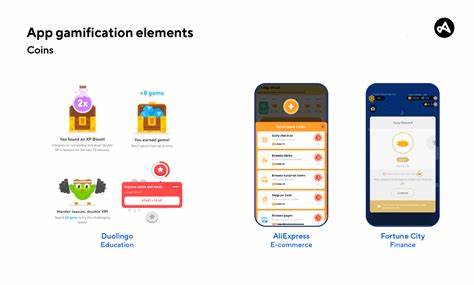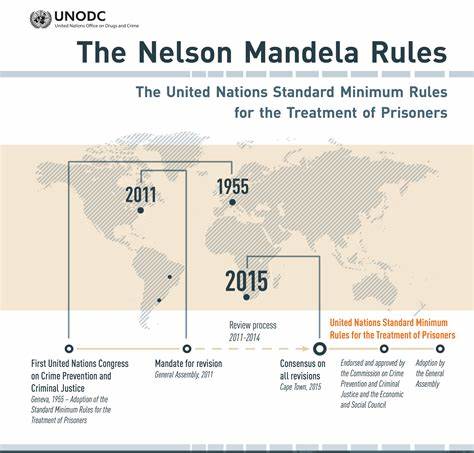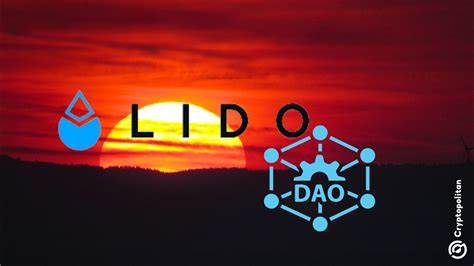Die Sprache, die wir verwenden, prägt, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Dies gilt besonders im Kontext von Verkehrsunfällen. Obwohl im deutschen Sprachgebrauch immer noch häufig von „Autounfällen“ die Rede ist, mehren sich Stimmen von Verkehrsicherheitsexperten und Aktivisten, welche die Verwendung dieses Begriffs kritisch hinterfragen. Sie argumentieren, dass das Wort „Unfall“ eine unglückliche, unvermeidliche Begebenheit suggeriert, die sich nicht verhindern lässt. Doch Fakten und Forschungsergebnisse zeigen, dass viele dieser Ereignisse vermeidbar sind.
Daher plädieren sie dafür, statt von „Unfällen“ von „Unfällen“ oder besser noch von „Zusammenstößen“ oder „Kollisionen“ zu sprechen, um das Bewusstsein für die Ursachen und die Prävention zu schärfen. Der Begriff „Unfall“ impliziert zufälliges, unvorhersehbares Geschehen ohne Schuld oder Verantwortlichkeit. Das Wort selbst schafft eine Art Abstand zwischen Ursache und Wirkung. Wenn ein Ereignis als Unfall bezeichnet wird, neigen Menschen dazu, eher passiv zuzusehen, anstatt aktiv nach Lösungen für die Vermeidung zu suchen. Im Gegensatz dazu weist der Begriff „Crash“ oder „Kollision“ auf eine konkrete Handlung hin, die meist durch menschliches Versagen, äußere Faktoren oder Fehlverhalten verursacht wird.
Hierdurch wird die Ursache des Geschehens ins Blickfeld gerückt und Verantwortliche können ermittelt werden, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Historisch betrachtet wurde das Wort „Unfall“ ursprünglich nicht im Kontext von Verkehrsunfällen verwendet. In den Anfangstagen der Automobilindustrie, Anfang des 20. Jahrhunderts, betrachtete die Öffentlichkeit Fahrzeuge noch als gefährliche Maschinen, die eine unmittelbare Bedrohung für Fußgänger darstellten. In Zeitungsberichten jener Zeit wurde meist nicht von „Unfällen“ gesprochen, sondern von „Kollisionen“ oder sogar von Tötungsdelikten, insbesondere wenn Fußgänger verwickelt waren.
Mit der Verbreitung der Autos änderte sich jedoch die Narrative. Automobilhersteller und Interessenverbände suchten nach Wegen, die zunehmende Kritik und Ablehnung der neuen Technologie zu dämpfen. Sie präferierten eine Sprache, die den Fahrer begünstigte und den Unfall als etwas Unvermeidbares erscheinen ließ. Um dies zu erreichen, wurden beispielsweise journalistische Leitlinien entwickelt, die die Verwendung von „Unfall“ und eine Verschiebung der Schuld auf Fußgänger propagierten. Ein berühmtes Beispiel ist die Einführung des Begriffs „Jaywalking“ in den USA – ein abwertender Ausdruck für Fußgänger, die die Straße außerhalb von Übergängen überqueren und somit als Schuldige dargestellt wurden.
Diese Sprachpolitik hat bis heute nachgewirkt, führt jedoch zu einer unterschwelligen Verharmlosung schwerwiegender Verkehrsvorfälle. Fachleute im Bereich Verkehrssicherheit erkennen das Problem und arbeiten daran, die Wortwahl in Medien, Polizei- und Amtsberichten sowie der Öffentlichkeit zu verändern. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in den USA etwa hat bereits in den 1960er Jahren empfohlen, auf den Begriff „Unfall“ zu verzichten, da dieser wenig zur Unfallprävention beiträgt. Auch Polizeibehörden großer Städte wie New York oder San Francisco verzichten heute bewusst auf „Unfall“ in ihren offiziellen Berichten. Das Ziel dieser sprachlichen Reform ist es, die Einstellung gegenüber Verkehrsunfällen zu verändern.
Wenn Zwischenfälle nicht als unvermeidliche Schicksalsschläge betrachtet werden, sondern als Ereignisse mit klarer Ursache und Vermeidbarkeit, führt dies zu einem stärkeren politischen und gesellschaftlichen Druck, Maßnahmen zu ergreifen, die die Sicherheit im Verkehr erhöhen. Dazu gehören verbesserte Verkehrsplanung, Tempolimits, der Ausbau geschützter Radwege, bessere Aufklärung über Alkohol am Steuer sowie ein konsequenteres Durchgreifen bei Verkehrsverstößen. Die Bedeutung dieser Veränderung im Sprachgebrauch zeigt sich auch darin, wie verschieden Menschen auf Meldungen reagieren, je nachdem, ob von einem „Autounfall“ oder einem „Autocrash“ gesprochen wird. Schuldbewusstsein und Verantwortung werden sensibilisiert, wenn das Ereignis als Ergebnis bestimmter Handlungen verstanden wird. Gleichzeitig erhöht sich das Bewusstsein dafür, dass Verkehrssicherheit keine Frage des Zufalls ist, sondern durch gezielte Maßnahmen beeinflusst werden kann.
Ein weiterer Aspekt der Diskussion betrifft die mediale Berichterstattung. Trotz voranschreitender Änderungen in politischer Kommunikation und Verwaltung hält sich die Verwendung von „Unfall“ in den Medien hartnäckig. Teilweise geschieht dies aus Gewohnheit oder aus stilistischer Vereinfachung, vielfach jedoch auch aus Mangel an Bewusstsein über die Bedeutung der Terminologie. Aktivisten und Organisationen wie „Transport Alternatives“ oder „Families for Safe Streets“ haben Kampagnen gestartet, um gerade Journalisten zu sensibilisieren und zur Nutzung der präziseren Begriffe zu ermuntern. Sie fordern auch von der Gesellschaft eine kritische Reflexion, um durch Sprache Veränderungen im Verhalten herbeizuführen.
Die Macht der Sprache bei gesellschaftlichen Veränderungen ist unumstritten. Wenn erfolgreiche Beispiele aus anderen gesellschaftlichen Bereichen betrachtet werden, zeigt sich, wie eine veränderte Wortwahl Einstellungen langfristig prägt – etwa im Zusammenhang mit Diskriminierung, Gesundheitsbewusstsein oder Umweltfragen. Verkehrssicherheit ist kein Ausnahmefall. Indem wir „Unfall“ durch Fakten-basierte und verantwortungssensible Begriffe ersetzen, stärken wir die gemeinsame Verantwortung und ermutigen zu einem aktiven Umgang mit Gefahrenquellen. Darüber hinaus liegt der Fokus nicht nur auf der Sprachwahl, sondern auch auf dem Verständnis der Ursachen von Verkehrskolliderationen.
Statistiken belegen beispielsweise, dass mehr als die Hälfte der tödlichen Unfälle durch Faktoren wie Alkohol am Steuer, zu hohe Geschwindigkeit und Ablenkung verursacht werden. Andererseits zeigen städtebauliche Maßnahmen, wie die Verbreiterung von Fußgängerzonen oder die Einrichtung von sogenannten Road Diets, dass sich Risiken durch gezielte Infrastrukturveränderungen deutlich reduzieren lassen. Die Erkenntnis, dass Kollisionen vermeidbar sind, sollte durch eine veränderte Sprache unterstrichen und gesellschaftlich verankert werden. Nicht zuletzt fördert die Distanzierung von der Begrifflichkeit „Unfall“ auch das Gefühl der Empathie und Wertschätzung gegenüber Opfern und Angehörigen. Die Begrifflichkeit „Unfall“ kann als verharmlosend und distanzierend empfunden werden, während „Kollision“ oder „Zusammenstoß“ den Ernst der Lage deutlicher hervorhebt und die Notwendigkeit einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Thema Verkehrssicherheit betont.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Art und Weise, wie wir über Verkehrsvorfälle sprechen, weitreichende Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft und individuelle Einstellungen hat. Eine bewusste Wortwahl kann dazu beitragen, die Prävention von Verkehrskollisionen voranzutreiben, Verantwortungsbewusstsein zu fördern und unsere Straßen sicherer zu machen. Wenn wir feststellen, dass „Flugzeugunfälle“ niemals als „Unfälle“ bezeichnet werden, warum sollte man dann bei Straßenverkehrsereignissen weiterhin eine Sprache verwenden, die deren Vermeidbarkeit und die Rolle der menschlichen Verantwortung verschleiert? Die Veränderung beginnt bereits mit dem bewussten Gebrauch von Sprache im Alltag und deren Übertragung in Medien und offizielle Kommunikation. Nur so kann nachhaltige Verkehrssicherheit erreicht werden, die Leben schützt und eine lebenswerte Umgebung schafft.