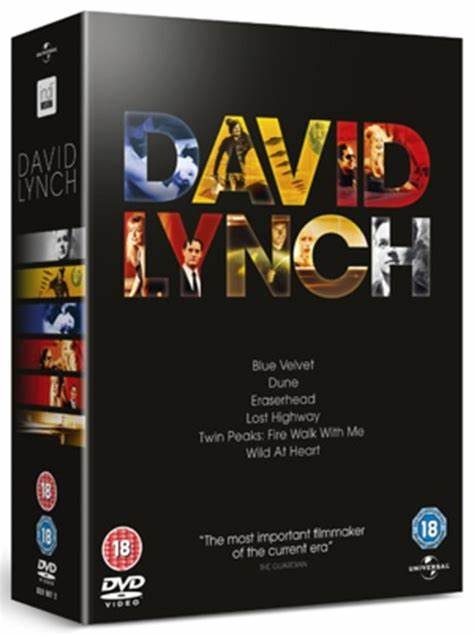Vor über 30 Jahren durchlebte Apple eine der ungewöhnlichsten Phasen seiner Firmengeschichte: die Einführung von Mac-Klonen. Eine Zeit, in der Apple anderen Herstellern erlaubte, Computer zu bauen, die das Mac OS ausführen konnten, und damit direkt mit dem eigenen Hardwareangebot konkurrierten. Diese Episode dauerte nur wenige Jahre, war aber von radikaler Bedeutung für den Kurs des Unternehmens und hinterließ bleibende Spuren in der Technologiebranche. In den frühen 1990er Jahren befand sich Apple in einer schwierigen Situation. Die Dominanz von Microsoft und Intel im PC-Markt setzte das Unternehmen unter starken Druck.
Apples Marktanteile schrumpften und das Unternehmen kämpfte mit finanziellen Problemen. Das Mac OS war zwar geliebt, doch das Hardware-Angebot konnte nicht mit der Vielfalt und Verfügbarkeit von Windows-PCs mithalten. Dies war die Ausgangslage, in der Apple einen ungewöhnlichen Schritt wagte: das Lizenzieren seines Betriebssystems an Drittanbieter. Die Idee hinter dem Klonprogramm war, den Mac OS weiter verbreiten zu können, ohne selbst jede Kunden- oder Nischenanforderung bedienen zu müssen. Diese Strategie sollte es ermöglichen, Märkte zu erschließen, die Apple selbst nur unzureichend bediente.
So bauten Unternehmen wie DayStar Digital und Power Computing eigene Computer mit Mac OS, die zum Teil mit innovativen Features und unterschiedlichen Modellen auf den Markt kamen. DayStar Digital, ansässig in Georgia, spezialisierte sich auf leistungsstarke Multiprozessor-Systeme, die für professionelle Anwender im Publishing-Bereich interessant waren. Diese Systeme waren schneller als die damaligen Apple-Modelle und wurden von Kunden genutzt, die maximale Rechenleistung benötigten, etwa für das Bearbeiten komplexer Grafik- und Fotodateien. DayStars Fokus auf Multi-Core-Prozessoren gehörte zu den ersten erfolgreichen Versuchen, Mac OS für parallele Verarbeitung zu optimieren – eine Entwicklung, die sich letztlich in modernen Macs mit mehreren Prozessorkernen widerspiegelt. Power Computing aus Texas verfolgte einen anderen Ansatz.
Inspiriert von Dell begann das Unternehmen, beige-farbene Computer in großer Stückzahl und mit konfigurierbaren Optionen online zu verkaufen. Damals war das noch ein Novum, denn PCs vor allem via Web oder Fax individuell zu bestellen, war neu und bahnbrechend. Diese Hersteller machten den Mac für ein breiteres Publikum zugänglicher und boten flexiblere Kaufmodelle, als Apple sie damals selbst anbot. Durch diese Direktvertriebsstrategie konnte Power Computing den Kunden mehr Auswahl und Anpassungsmöglichkeiten bieten. Obwohl Apple die Grundlage für Hardware und Software lieferte, überließen sie den Klonherstellern doch viele Freiheiten, ihre Geräte auf Kundenbedürfnisse hin weiterzuentwickeln.
Die Klone basierten häufig auf bestehenden Apple-Motherboards, doch die Experimentierfreude bei den Klonherstellern führte zu teils schneller Innovation. So beeindruckte die Ära durch technische Lösungen, die Apple selbst noch nicht umgesetzt hatte. Mit der Rückkehr von Steve Jobs an die Spitze von Apple im Jahr 1997 sollte dieses Kapitel allerdings ein abruptes Ende finden. Jobs betrachtete die Lizenzierung des Mac OS an andere Hersteller als existenzielle Bedrohung für Apples Profitabilität und den Fortbestand des Mac-Ökosystems. In einer internen Mitteilung erklärte er, dass die Klon-Hersteller weder die Kosten für Entwicklung und Marketing ausreichend decken noch nachhaltig zum Wachstum von Apple beitragen könnten.
Vielmehr gefährde das Klonprogramm das Überleben von Apple und seiner Partner. Jobs reagierte konsequent und entließ das Klonprogramm mit sofortiger Wirkung. Apple änderte die Benennung der nächsten Betriebssystemversion in Mac OS 8, sodass Klone keinen Zugang zu den neuesten Software-Features oder neuen Chip-Generationen mehr hatten. Zudem wurden die Lizenzen nicht verlängert, was die Klonhersteller in ihrer Entwicklung stark einschränkte und letztlich aus dem Markt drängte. Ein interessantes Nebenelement dieser Ära war die Entstehung der Marke Mac OS selbst.
Bis dahin hatte das System nur als „System“ oder „System 7“ existiert, ohne klare Produktidentität. Die Notwendigkeit, das Betriebssystem für Klonhersteller und Kunden als eigenständiges Produkt zu kennzeichnen, führte zur Namensgebung Mac OS und dem ikonischen Logo mit den zwei lachenden Gesichtern. Diese Markierung begleitet Apple bis heute und ist für viele Nutzer ein Synonym für das Mac-Betriebssystem. Der Einfluss der Mac-Klone ist trotz ihrer kurzen Lebensdauer auch heute noch spürbar. Das Direktvertriebskonzept, das Power Computing etablierte, diente Apple später als Vorbild, um den Kaufprozess für Macs kundenfreundlicher zu gestalten.
Heutzutage sind maßgeschneiderte Macs direkt über Apple konfigurierbar, was ohne die Pionierleistungen der Klonhersteller schlechter vorstellbar wäre. Die technische Entwicklung im Bereich Mehrkernprozessoren, angestoßen von DayStars Genesis MP, legte die Grundlage für moderne Multithreading-Architekturen in Macs. Die reine Nutzung von mehreren Prozessorkernen, um die Performance zu steigern, wurde zu einem Standard und ist heute integraler Bestandteil jeder Mac-Generation – vom Power Mac 9500 über die Power Mac G5 bis hin zu aktuellen Apple Silicon Modellen. Auch finanziell war die Klonära nicht der Hauptgrund für Apples Schwierigkeiten in den 1990er Jahren, wie Jobs klarstellte. Die Mac-Verkäufe hatten generell um fast 20 Prozent abgenommen, und die Klonhersteller bildeten nur einen kleinen Anteil am Gesamtmarkt.
Vielmehr standen Apples Probleme tiefer und erforderten umfassende Neuausrichtungen. Eine weitere nachhaltige Folge: Apple erwarb 1997 die Kernanteile von Power Computing zum Preis von zehn Millionen Dollar in bar und hundert Millionen Dollar in Apple-Aktien. Der Kauf sollte zwar auch juristische Risiken mindern, doch vor allem wollte Apple von der Expertise im Direktvertrieb profitieren. Dieses Wissen trug dazu bei, dass Apple den Online-Store für Mac-Produkte professionell ausbaute und erfolgreich machte. Rückblickend wirkt die Mac-Klon-Ära wie ein ungewöhnliches Experiment aus der Not heraus, das viele Lektionen für Apple enthielt.
Es zeigte, wie wichtig Kontrolle über Hard- und Software für ein ganzheitliches Nutzererlebnis ist, aber auch wie innovativ und dynamisch Wettbewerber durch neue Vertriebswege und technische Konzepte sein können. Mac-Fans erinnern sich erst heute mit Erstaunen an jene Zeit, in der Apple plötzlich fremden Firmen erlaubte, Macs zu bauen. Aus der Perspektive von heute, mit stark integrierten Apple Silicon Macs und einer klaren Produktstrategie, erscheint die Klon-Zeit beinahe wie ein Fremdkörper in der Firmengeschichte. Doch ohne dieses kurze, wilde Kapitel wären viele spätere Innovationen und auch Apples heutiger Erfolg womöglich nicht denkbar. Die Mac-Klon-Ära hat mehr Spuren hinterlassen, als auf den ersten Blick sichtbar ist.