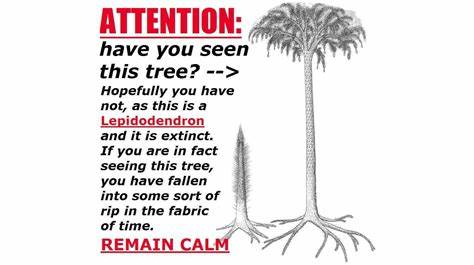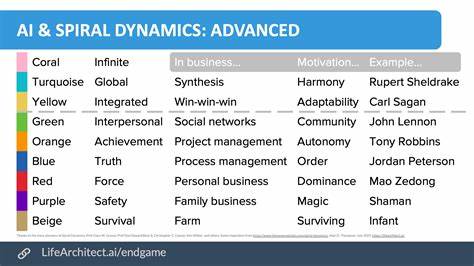Die Vorstellung, dass jedes Bild, das wir je gesehen haben, bereits irgendwo existiert, lässt zunächst an Science-Fiction oder philosophische Spekulationen denken. Doch wenn man sich mit der digitalen Welt und den zugrundeliegenden Prinzipien der Informationsverarbeitung beschäftigt, wird schnell klar, dass diese Idee eine reale Grundlage hat. Um das zu verstehen, muss man zunächst die Struktur digitaler Bilder begreifen und die schiere Größe des Bildraums erfassen, der durch die Kombination von Pixeln und Farben entsteht. Digitale Bilder bestehen aus Pixeln, kleinen Bildeinheiten, die jeweils eine Farbe darstellen. Das klassische Beispiel eines sehr kleinen Bildes könnte eine 3×3 Pixel große Grafik sein.
Wenn man hier nur Schwarz- und Weißtöne zulässt, gibt es für jeden der neun Pixel nur zwei mögliche Farben. Mathematisch lässt sich die Anzahl der möglichen Bilder durch 2 hoch 9 ausdrücken, was 512 Bildern entspricht. Diese Zahl ist überschaubar und lässt sich leicht visualisieren. Man kann sich also vorstellen, dass alle denkbaren kleinen Schwarzweiß-Bilder mit dieser Auflösung komplett erzeugt werden könnten. Die wirkliche Herausforderung tritt jedoch auf, wenn man diese Idee auf ein Bild mit moderner Standardauflösung überträgt, etwa auf Full-HD mit 1920×1080 Pixeln und einer Farbtiefe von 24 Bit, was mehr als 16 Millionen Farben pro Pixel bedeutet.
Hier wird die Anzahl der möglichen Bilder zu einer astronomischen Zahl. Diese reicht ungefähr an 10 hoch 14 Millionen Stellen – eine Zahl so groß, dass sie jegliche Vorstellungskraft sprengt und selbst die Anzahl der Atome im beobachtbaren Universum bei Weitem übertrifft. Diese Erkenntnis wirft eine tiefgreifende Frage auf: Ist in diesem gigantischen Möglichkeitsraum schon jedes Bild enthalten, das jemals gemacht wurde, gemacht werden könnte oder zumindest denkbar ist? Jedes Foto deiner Kindheit, jede Erinnerung, jedes Kunstwerk und sogar völlig absurde oder unmögliche Szenen – sie sind alle Teil dieses endlichen, aber überwältigend großen Bilduniversums. Natürlich besteht der Großteil dieses Bildraums aus zufälligem Rauschen, farblich vollkommen chaotischen und sinnlosen Musterfolgen, die keinen erkennbaren Zusammenhang aufweisen. Doch irgendwo tief in dieser Masse existieren alle geordneten und bedeutungsvolllen Bilder.
Das bedeutet im Grunde, dass das scheinbar Neue nicht neu sein muss, sondern schon vorher in irgendeiner Form vorhanden war – zumindest digital und theoretisch. Diese Überlegung lässt sich auch als Erweiterung des Gedankens verstehen, dass Informationen nicht verloren gehen, sondern nur transformiert oder verborgen werden. Wenn man bedenkt, dass Computer und Algorithmen in der Lage sind, jedes dieser Bilder durch bestimmte Ansätze zu generieren oder zu identifizieren, ist es denkbar, dass wir eine Art digitale Schatzkammer von Bildern entdecken könnten, die bisher unbekannt waren. Wie aber verhält es sich mit dem praktischen Nutzen dieser Erkenntnis? Einerseits zeigt sie die Grenzen dessen auf, was tatsächlich „neu“ geschaffen werden kann. Wenn alles Mögliche schon irgendwo existiert, sind kreative Prozesse im Grunde eine Erkundung dieser bereits vorhandenen Möglichkeiten – ein Auffinden statt ein Erfinden.
Andererseits sensibilisiert es uns dafür, welche Rolle der Kontext, die Wahrnehmung und das Bewusstsein spielen, um Bedeutung zu erzeugen. Ein Bild wird erst durch unsere Betrachtung zu „echt“ oder „bedeutungsvoll“. Mathematische Theorien und informatische Prinzipien unterstützen diese Sichtweise. Nach dem Shannon'schen Informationstheorem gibt es Grenzen, wie stark sich Daten komprimieren und dennoch verlustfrei wiederherstellen lassen. Einige extremer behauptete Beispiele wie der Sloot-Digital-Coding-System-Vorfall aus den 1990er Jahren, der die Speicherung ganzer Filme in nur wenigen Kilobytes versprochen hat, konnten nie reproduziert oder verifiziert werden und stehen eher als Warnung vor Missverständnissen in der Interpretation dieser mathematischen Grenzen.
Auf einer philosophischen Ebene erinnert die Vorstellung eines All-Enthaltenden Bildraums an Konzepte wie die „Bibliothek von Babel“, inspiriert von Jorge Luis Borges. Diese Bibliothek soll alle erdenklichen Buchseiten enthalten — sinnvoll, sinnlos, bereits Geschriebenes und Ungeschriebenes. Genauso könnte man sich vorstellen, dass in der digitalen Welt ein ähnliches Universum der Bilder existiert. Angesichts dessen stellt sich auch die Frage, ob Kreativität und Erfindung neu sind oder ob wir vielmehr eine riesige digitale Landschaft abgrasen, die schon vor unserer Zeit in gewisser Weise existierte. Doch wie lassen sich diese abstrakten Gedanken in der Praxis nutzen? Im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Bildgenerierung sind Techniken wie neuronale Netze und Generatoren in der Lage, auf Basis großer Bilddatensätze neue Bilder zu erzeugen.
Interessanterweise könnten solche Systeme theoretisch in dem unermesslichen Meer der möglichen Bilder navigieren, um ganz neue Kombinationen zu schaffen, indem sie bereits existierende Muster kombinieren und variieren. So spiegelt sich die Idee wider, dass Bilder nicht unbedingt völlig neu erfunden werden, sondern aus der Erkundung eines riesigen, vordefinierten Möglichkeitsraums hervorgehen. Die moderne Kompression von Bildern und Videos zeigt zudem, dass viele Daten eine starke Redundanz besitzen. Algorithmen wie JPEG oder MPEG nutzen diese, um Dateigrößen zu reduzieren, ohne das Bild für das menschliche Auge merklich zu verändern. Das unterstreicht, dass die Menge an Informationen, die für ein sinnvolles Bild nötig sind, häufig deutlich geringer ist als die theoretische Obergrenze der Kombinationen aller Pixel und Farben.
Dies unterstützt die Annahme, dass unsere Welt der Bilder eine kleine, strukturierte Insel innerhalb einer riesigen Landschaft von Zufallsbildern ist. Allerdings gibt es Begrenzungen. Wenn man sich vorstellt, Bildauflösung und Farbtiefe unendlich zu erhöhen, nähert sich die Menge der möglichen Bilder einer unendlichen Raumgröße, die nicht mehr mit endlichen Zahlen zu beschreiben ist. So entgeht die oben beschriebene Endlichkeit einem zunehmend abstrakten und theoretischen Übermaß. Doch solange wir in bekannten digitalen Formaten arbeiten, gilt die Tatsache der endlichen, aber extrem großen Bildmenge.
Spannend wird das Thema auch, wenn man die Unterscheidung zwischen „Existenz“ und „Präsenz“ betrachtet. Etwas kann in einem mathematischen Raum oder als Datenmuster existieren, doch erst durch Wahrnehmung und Kontext wird es für uns real oder bedeutsam. Das Bild deines Urlaubs in der Kindheit ist nicht nur eine Kombination von Pixeln, sondern trägt Erinnerungen und Emotionen. Es existiert als Datei, aber auch in deinem Geist und in deinem sozialen Umfeld. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jedes Bild, das wir jemals gesehen haben, tatsächlich schon Teil eines unvorstellbar großen digitalen Universums aller möglichen Bilder ist.
Diese Erkenntnis weckt Fragen über Kreativität, Wahrnehmung und die Natur von Information. Sind wir nur Entdecker in einer schon existierenden Welt von Möglichkeiten? Oder sind wir tatsächlich Schöpfer, die aus dem Nichts etwas Neues erschaffen? Vielleicht ist die Antwort darauf komplexer als gedacht und verbindet beides: wir erschaffen und entdecken gleichzeitig, während wir durch die digitale Unendlichkeit navigieren.