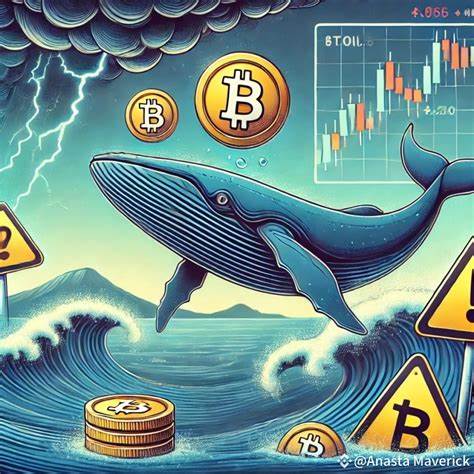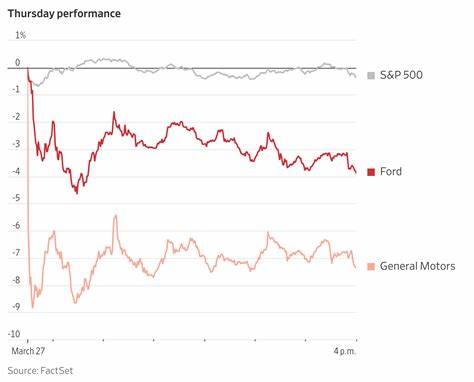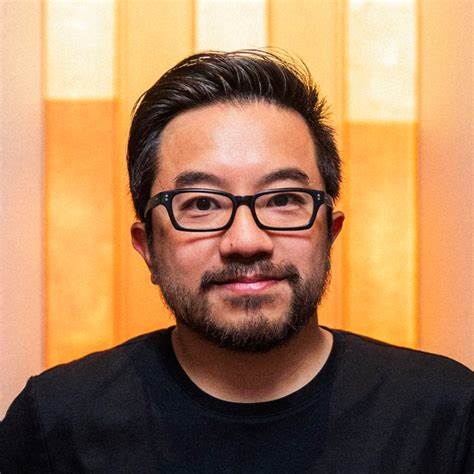In den letzten Jahren hat das Thema Diversity, Equity und Inclusion (DEI) verstärkt Einzug in Unternehmen verschiedenster Branchen gehalten. Die Absicht dieser Programme ist es, Chancengleichheit zu gewährleisten und diskriminierende Strukturen abzubauen. Doch wie weit gehen solche Initiativen, ehe sie selbst zu einer Diskriminierung führen? Eine brisante Enthüllung eines Whistleblowers bei Lockheed Martin, einem der weltweit größten Rüstungs- und Technologiekonzerne, wirft ein Licht auf diese komplexe Fragestellung. Demnach soll Lockheed Martin Boni nicht allein aufgrund der Arbeitsleistung vergeben, sondern gezielt auch nach Hautfarbe ausgewählt haben. Dieser Bericht hat in den USA eine breite Diskussion ausgelöst und ruft grundlegende Fragen zum Umgang mit Diversity-Programmen in profitgetriebenen Unternehmen hervor.
Der Fall beginnt im Dezember 2022, als ein Mitarbeiter mit der Planung der Jahresboni für die Aeronautik-Abteilung von Lockheed Martin beschäftigt war. Obwohl sein Team sorgfältige Berechnungen und Bewertungen der individuellen Leistungen erstellte, erhielt der Whistleblower bald Hinweise aus den höheren Ebenen der Unternehmensführung, insbesondere aus der Personalabteilung, dass die Zusammenstellung der Bonusempfänger nicht den Anforderungen an die sogenannte Diversität entspreche. Konkret wurde kritisiert, dass auf der Liste zu viele weiße Mitarbeiter aufgeführt seien. Im weiteren Verlauf erhielt der Whistleblower klare Anweisungen, die Bonusempfängerliste zu verändern, indem zahlenmäßig mindestens ebenso viele Mitarbeiter aus Minderheiten zum Kreis der Begünstigten hinzugefügt und gleichzeitig diese Auswahl auf Kosten weißer Beschäftigter erfolgen sollte. Santiago Bulnes, der zuständige Vizepräsident für ein bedeutendes Lockheed-Martin-Programm, meldete sich in einer Mail bei dem Whistleblower.
Er erklärte, dass die Personalleitung von La Wanda Moorer, der Personaldirektorin, darauf dränge, gewisse Anzahl an Minderheiten („POC“ – People of Color) in der Bonusliste unterzubringen. Es wurde auf Anweisungen hingewiesen, welche Mitarbeiter entfernt und durch Minderheiten ersetzt werden sollten. Für einige Teams wurde explizit verlangt, die Anzahl der POC um vier zu erhöhen und gleichzeitig die gleichen vier nicht-minoritären Mitarbeiter von den Bonuszahlungen auszunehmen. Die Aufforderung, Boni auf Basis von Hautfarbe zu vergeben und nicht nach Leistung, stellt eine deutliche Abweichung von meritokratischen Prinzipien dar und verstößt offensichtlich gegen das zivile Antidiskriminierungsrecht. Der Whistleblower zeigte sich schockiert und versuchte, gegen diese Praxis zu protestieren, da sie nicht nur moralisch fragwürdig, sondern auch juristisch problematisch sei.
Trotz formal eingereichter Ethikbeschwerden wurde der Mitarbeiter von der Führungsebene angewiesen, diesen Forderungen zu entsprechen. Es wurde sogar unter Hinweis auf potenzielle Geschäftsrisko argumentiert, dass dieser Kurs dennoch der „kleinere Übel“ sei im Vergleich zu möglichen Reaktionen, die durch das Nichtbefolgen entstehen könnten. Dabei wurde deutlich, dass die Unternehmensverantwortlichen bereit waren, legale Grenzen zu überschreiten, um vermeintlich den Diversitätsanforderungen gerecht zu werden. Die Rolle von La Wanda Moorer als Personaldirektorin wird in diesem Kontext besonders hervorgehoben. Auf die Nachfrage, was passieren würde, falls nicht ausreichend Minderheiten zur Auswahl stünden, antwortete sie offenbar mit der Aufforderung, das Ziel verpflichtend zu erreichen, auch wenn dies rechtliche Konsequenzen mit sich bringen könnte.
Der deutliche Hinweis, dass diese Vorgänge offenbar nicht neu seien, lässt vermuten, dass Lockheed Martin schon zuvor gezielt Boni nach dem Kriterium der Hautfarbe vergeben hatte – unabhängig von der individuellen Leistung. Diese Haltung illustriert die Prioritäten des Unternehmens: Die Umsetzung von DEI-Programmen mit einem starken Fokus auf Zahlen und Quoten schien wichtiger als Meritokratie und juristische Integrität. Der Whistleblower erfüllte schließlich den Auftrag und tauschte 18 weiße Mitarbeiter, die auf Basis ihrer Leistung eigentlich für eine Bonuszahlung vorgesehen waren, gegen 18 Minderheiten aus, die diese Leistung nicht erbrachten. Nach diesen Vorgängen verließ der Mitarbeiter das Unternehmen und veröffentlichte eine Abschiedsnachricht, in der er seine Freiwilligkeit erklärte, weil er nicht länger an einer Unternehmenskultur mitwirken wolle, welche Leistung und Fairness derart verletze. Er warnte zudem vor möglichen Klagen gegen Lockheed Martin sowie dem Vertrauensverlust bei Kunden und der Öffentlichkeit.
Aus Unternehmenssicht reagierte Lockheed Martin mit einer Stellungnahme, in der sie betonten, das Unternehmen basiere auf Meritokratie und Leistungsehrung und verurteilten die Anschuldigungen als Gegenstand der laufenden Prüfung. Allerdings konnte diese Verteidigung bislang nicht die besorgniserregenden Erkenntnisse neutralisieren, zumal in den USA die politische Rechtslage sich zuletzt zugunsten der Gleichbehandlung aller Rassen und unter Widerspruch zu expliziter Bevorzugung in Diversity-Programmen verändert hat. Der Kontext dieser Entwicklungen ist wesentlich und erklärt, warum so ein Fall bei einem Konzern wie Lockheed Martin, der traditionell als leistungsorientiert galt, bekannt geworden ist. Die Ära nach den George-Floyd-Protesten führte zu einer verstärkten Implementierung von Diversity-Maßnahmen in Unternehmen, auch in eher konservativen Branchen. Soziale Bewegungen und politische Korrektheit setzten viele Firmen unter Druck, Programme einzuführen, die vor allem Minderheiten bevorzugten – ohne immer hinreichend rechtliche Grenzen oder die tatsächlichen Auswirkungen zu bedenken.
Dass auch ein militärisch geprägtes Unternehmen wie Lockheed Martin sich dieser Kultur anpasste, ist ein Beleg dafür, wie weit soziale Themen inzwischen in alle Bereiche der Wirtschaft vorgedrungen sind. Dies wirft die Frage auf, wie Unternehmen zukünftig mit Diversity umgehen sollten, um sowohl gesellschaftlichen Forderungen gerecht zu werden als auch individuelle Rechte zu schützen. Eine Balance zwischen Förderung von Chancengleichheit und Meritokratie ist nötig, damit Mitarbeitermotivation und Leistung nicht darunter leiden. Diskriminierung, ganz gleich welcher Art, kann zu Rechtsstreitigkeiten, internem Misstrauen und letztlich wirtschaftlichem Schaden führen. Zusätzlich sollte die Rolle der verantwortlichen Führungskräfte beleuchtet werden.
Ein Klima, in dem Vorgaben gesetzt werden, die Performance zurückzustellen oder gar gezielt zu übergehen, zerstört die Glaubwürdigkeit der Personalführung und der gesamten Mitarbeiterkultur. Solche Anweisungen erwecken den Eindruck, dass Hautfarbe wichtiger sei als persönliche Leistung – ein Umstand, der dem Leitbild vieler High-Tech-Unternehmen, auch im Verteidigungssektor, grundsätzlich widerspricht. Die Reaktion der US-Regierung zeigt ebenfalls, dass die Zeiten sich ändern. Im Jahr 2025 unterzeichnete Präsident Trump eine Exekutivverordnung, die es untersagte, dass Bundesauftragnehmer diskriminierende DEI-Programme weiterführen. Die neue Rechtssprechung stellt sicher, dass Unternehmen gleich behandelt werden müssen und das Vorzugsbehandlungen aufgrund von Hautfarbe oder Geschlecht nicht zulässig sind.
Die Führung der Justice Department Civil Rights Division unter Harmeet Dhillon signalisiert zudem eine strikte Durchsetzung dieser Regelungen. Für Lockheed Martin und andere Großunternehmen bedeutet dies, dass die Zeit eindeutig für eine Rückbesinnung auf transparente, leistungsgerechte Vergabepraktiken gekommen ist. Sowohl die öffentliche Wahrnehmung als auch rechtliche Konsequenzen zwingen zur Klärung und Neujustierung der Unternehmenspolitik. Whistleblower wie in diesem Fall spielen eine entscheidende Rolle, um Missstände aufzuzeigen und gesellschaftliche Debatten zu fördern, die letztlich zu faireren Arbeitsumgebungen führen können. Abschließend zeigt der Fall Lockheed Martin exemplarisch die Herausforderungen und Fallstricke, die bei der Umsetzung von Diversity-Programmen entstehen können.
Der Spannungsbogen zwischen Gleichstellung und individueller Leistung ist komplex und verlangt eine sorgfältige Abwägung. Unternehmen sind gefordert, Maßnahmen zu entwickeln, die alle Mitarbeiter gleichermaßen respektieren und fördern, ohne jedoch die Rechtsstaatlichkeit und Leistungsorientierung zu gefährden. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie der Dialog um Diversity weitergeführt und rechtskonform ausgeprägt wird, um gerechte und motivierende Arbeitsplätze zu schaffen.