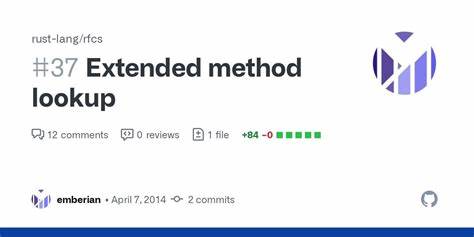Das Pi Network sorgte bei seiner Einführung im Jahr 2019 für erhebliches Aufsehen. Die Idee war genial simpel und versprach einen leichten Zugang zur Kryptowelt: Mining von Kryptowährungen direkt über das Smartphone – ohne teure Hardware oder immense Stromkosten, einfach nur einmal täglich auf eine App tippen. Diese innovative Methode lockte Millionen Nutzer weltweit an, überzeugt von der Chance, frühzeitig Teil eines potenziellen Krypto-Giganten zu sein. Bis zu 70 Millionen Menschen registrierten sich für die Plattform, begeistert von der „kostenlosen“ Möglichkeit, digitale Münzen zu sammeln und dabei ein soziales Netzwerk zu nutzen, das auf einem Empfehlungsmodell basierte. Doch was einst wie die Zukunft des mobilen Krypto-Minings aussah, entpuppte sich mit der Zeit als ein Projekt mit zahlreichen Problematiken und ungewisser Zukunft.
Die erste Euphorie begann bald zu schwinden, als der langfristige Erfolg des Pi Networks infrage gestellt wurde und viele Nutzer Zweifel an der Seriosität und Nachhaltigkeit hatten. Die technische Grundlage von Pi basiert auf dem Stellar Consensus Protocol (SCP), das als energieeffizienter und dezentralisierter Ansatz gegenüber dem energieintensiven Bitcoin Mining angepriesen wurde. Dies sollte einen weiteren wichtigen Vorteil darstellen und das Projekt von etablierten Kryptowährungen differenzieren. Der ursprünglich geplante Fahrplan versprach einen schrittweisen Übergang: Nach der Phase des mobilen Minings sollte ein Testnetzwerk folgen, daraufhin ein KYC-Prozess (Know Your Customer), welcher dabei helfen sollte, Identitäten zu verifizieren, und schließlich der Start des Mainnets – der voll funktionsfähigen Blockchain mit echten Handelsmöglichkeiten und Anwendungen. Doch gerade letzterer Punkt verzögerte sich massiv.
Über Jahre hinweg warteten Nutzer vergeblich auf die Mainnet-Lösung. Erst Anfang 2025 wurde ein echtes Mainnet gestartet, jedoch brachte auch dieses Ereignis mehr Frust als Freude mit sich. Der Wechsel der Guthaben auf das Mainnet gestaltete sich für viele Nutzer kompliziert: KYC-Verifizierungen wurden zur Stolperfalle und technische Hürden machten es vielen schwer, ihre seit Jahren gesammelten Tokens zu transferieren. Der Handel mit Pi begann zwar auf einigen Plattformen, doch die Euphorie währte nur kurz. Nach einem kurzen starken Preisanstieg auf beinahe 3 US-Dollar im Februar 2025 kam es zu einem dramatischen Einbruch.
Die Kurse stürzten auf rund 0,58 US-Dollar im Mai 2025 ab, wodurch ein Großteil des zuvor aufgebauschten Werts verlorenging. Diese Preisschwankungen führten zu wachsendem Misstrauen. Ein weiteres gravierendes Problem war das fehlende Ökosystem. Gegenwärtig gibt es kaum real nutzbare Anwendungen, in denen Pi als Zahlungsmittel eingesetzt werden kann. Lediglich kleinere Community-Märkte oder Pilotprogramme erlauben begrenzte Transaktionen.
Die Vision, eine umfassende Plattform mit zahlreichen Diensten zu schaffen, ist bislang nur unzureichend Realität geworden. Aus der aktiven Krypto-Community kamen zunehmend kritische Stimmen. Viele Nutzer verloren mit der Zeit ihr Vertrauen, da sich vermeintliche Versprechen nicht erfüllten und Transparenz weitestgehend fehlte. Sechs Jahre nach Projektstart ließ die versprochene Offenheit auf sich warten. Trotz aller Vorgaben zur Dezentralisierung besitzt das Kernteam eine weitgehende Kontrolle über das Netzwerk.
Sie betreiben sämtliche Hauptknotenpunkte und halten große Mengen der Token. Diese Zentralisierung widerspricht grundlegenden Prinzipien der Kryptowelt und weckt bei vielen den Verdacht, es handele sich eher um eine private Unternehmung als um eine echte, verteilte Blockchain. Auch die mangelnde Transparenz bei den technischen Details sorgt für kritische Fragen. Das Whitepaper bleibt vage, genaue Informationen zu Tokenomics, Zeitplänen für Token-Freigaben oder Mechanismen wie Token-Burn sind kaum vorhanden. Ohne diese Einblicke fällt es schwer, die langfristige Gesundheit und das Potenzial des Projekts einzuschätzen.
Ein weiteres Hemmnis sind die begrenzten Börsen, auf denen Pi gehandelt wird. Große und bekannte Börsen wie Binance oder Coinbase führen Pi nicht, und bei kleineren Plattformen berichten Nutzer immer wieder von Problemen beim Ein- und Auszahlen der Tokens. Verzögerungen, fehlende Kommunikation und technische Schwierigkeiten prägen den Handel. Zudem sorgten Berichte über plötzliche Sperrungen von Abhebungen oder ungewöhnlich große Token-Bewegungen für Spekulationen über Marktmanipulation. Die anfangs hohe Handelsaktivität, zum Teil im Milliardenbereich, schrumpfte binnen weniger Monate dramatisch auf nur noch ca.
40 Millionen US-Dollar. Ob der ursprüngliche Hype durch echte Nachfrage oder durch künstliche Volumina entstand, bleibt unklar. Für viele Nutzer fühlt es sich an, als seien sie in einem geschlossenen System gefangen, ohne ausreichende Möglichkeiten, ihre Token sinnvoll einzusetzen oder in andere Währungen umzuwandeln. Neben diesen technischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten stellt sich die grundlegende Frage: Handelt es sich bei Pi Network um einen Betrug oder schlicht um eine Überambition? Auf den ersten Blick weist Pi nicht die typischen Merkmale eines klassischen Betrugs auf. Kein Initial Coin Offering (ICO), kein finanzielles Risiko durch den Kauf von Tokens, sondern nur ein App-Download und tägliches Mining durch Tippen.
Das machte den Einstieg niedrigschwellig und verhalf dem Projekt zu seiner enormen Nutzerbasis. Allerdings nimmt die Struktur, die stark auf Empfehlungen und das Einladen neuer Nutzer setzt, zunehmend Züge eines Multi-Level-Marketings an. Zusammen mit Monetarisierungsstrategien wie Werbung in der App und der KYC-Pflicht, bei der persönliche Daten verlangt werden, entsteht ein Mischbild – die Nutzer zahlen nicht mit Geld, sondern mit ihrer Zeit, Aufmerksamkeit und privaten Informationen. Örtliche sowie internationale Experten und Branchenführer äußerten öffentlich Zweifel bezüglich der Seriosität des Pi Network. Die Ursache des Zweifels liegt somit nicht unbedingt in kriminellen Absichten, sondern oft in undurchsichtigen Praktiken und mangelnder Glaubwürdigkeit.
Die offizielle Einführung des Netzwerks am 14. März 2019 – dem sogenannten Pi-Tag – mag symbolisch für Mathematik stehen, aber die Realität entwickelte sich weit weniger eindeutig. Blickt man in die Zukunft, stellt sich die Frage, ob und wie das Pi Network eine Chance auf Erholung hat. Theoretisch geben Transparenz und das Öffnen des Quellcodes wichtige Impulse, um Vertrauen zurückzugewinnen. Der wichtigste Schlüssel aber liegt in der Schaffung echter Anwendungsmöglichkeiten: Nur wenn Pi als Zahlungsmittel oder als Grundlage für dezentrale Applikationen genutzt werden kann, entsteht langfristiger Wert.
Ebenso wäre eine breitere Listung an bedeutenden und regulierten Krypto-Börsen essentiell, da nur so Liquidität und Preisfindung nachhaltig gestützt werden können. Aktuell sind zentralisierte Governance-Strukturen hinderlich. Ein wirklicher Fortschritt erfordert die Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen, um dem Geist der Blockchain gerecht zu werden – nämlich die Macht von einer kleinen Elite zu einer vielfältigen Gemeinschaft zu verteilen. Doch selbst wenn all diese Herausforderungen erfolgreich gemeistert würden, bleibt die Frage, ob Pi Network nach mehreren enttäuschenden Jahren tatsächlich noch eine Chance hat, gegen etablierte Projekte zu bestehen. Die Nutzeraktivität sinkt, die mediale Aufmerksamkeit nimmt ab, und die einstige Begeisterung scheint verblasst.
Die kommenden Monate und Jahre werden zeigen, ob sich Pi neu erfinden kann oder ob es in Vergessenheit gerät – als Mahnmal für ein ambitioniertes Projekt, das seine Versprechen nicht einlöste.