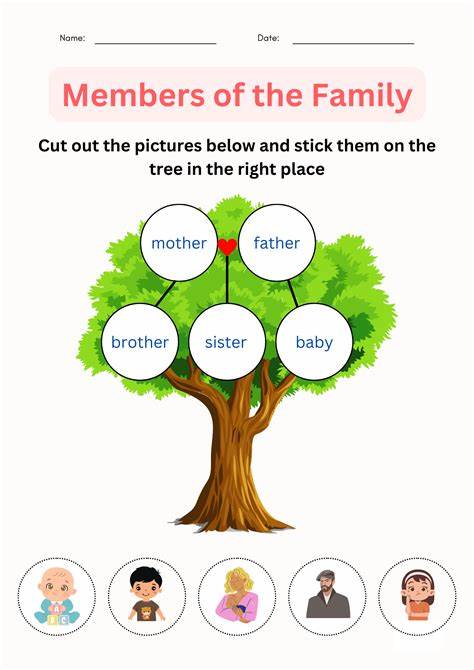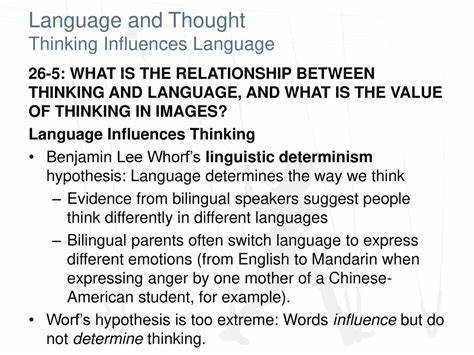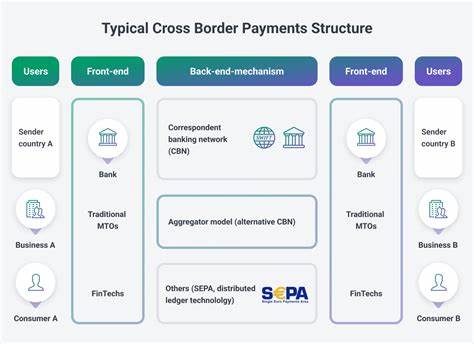Die demografische Entwicklung ist in vielen Teilen der Welt alarmierend. Besonders in Industrienationen wie den USA, Japan oder zahlreichen europäischen Ländern sinkt die Geburtenrate seit Jahrzehnten kontinuierlich. Eine schrumpfende Bevölkerung stellt sowohl ökonomische als auch gesellschaftliche Herausforderungen dar. Die Sorge um eine zu geringe Geburtenrate ist nicht unbegründet: Weniger Kinder bedeuten zukünftig eine geringere Erwerbsbevölkerung, höhere Belastungen im Sozialversicherungssystem und potenziell einen Rückgang des Wirtschaftswachstums. Entgegen einer verbreiteten Meinung, dass finanzielle Anreize für Familien wenig Wirkung zeigen, liefert das Institute for Family Studies (IFS) umfangreiche Belege, dass gezielte Zahlungen an Familien mit Kindern tatsächlich die Geburtenrate anheben können.
Dieses Phänomen wird als „Cash for Kids“ bezeichnet und hat weltweit positive Auswirkungen gezeigt.Die Situation in den USA ist exemplarisch. Dort liegt die durchschnittliche Zahl an Kindern pro Frau bei unter 1,6, was deutlich unter dem notwendigen Ersatzniveau von etwa 2,1 liegt. Dies bedeutet, dass die Bevölkerung ohne Zuwanderung langfristig schrumpft. Angesichts der Bedeutung der Kinder für die ökonomische Zukunft eines Landes hat das IFS vorgeschlagen, die bestehenden steuerlichen Kindergutschriften deutlich auszubauen, um Familien finanziell stärker zu entlasten und so Anreize für mehr Geburten zu schaffen.
Konkret schlagen die Forscher vor, die reguläre Kindergutschrift pro Kind auf 2000 US-Dollar anzuheben, ergänzt durch eine zusätzliche rückzahlbare Gutschrift, die besonders auch einkommensschwachen Familien zugutekommt. Dies wäre eine erhebliche Steigerung im Vergleich zu den gegenwärtigen Leistungen. Die Argumentation stützt sich auf bisherige Erfahrungen und eine Vielzahl von internationalen Studien.Wie belegen solche Studien den Einfluss von Geldleistungen auf das Geburtenverhalten? Eine umfangreiche Analyse von 43 Studien mit 58 politischen Maßnahmen aus zahlreichen Ländern zeigt eine klare Korrelation: Je großzügiger die finanzielle Unterstützung für Familien, desto stärker steigen die Geburtenraten an. Von den untersuchten Nationen haben vor allem Länder wie Ungarn, Japan, Mongolei und die Tschechische Republik ihre familienpolitischen Maßnahmen gezielt ausgebaut und konnten in der Folge eine positive Entwicklung bei den Geburten verzeichnen.
Dabei handelt es sich nicht nur um kurzfristige Verschiebungen der Geburtszeitpunkte, sondern um nachhaltige Steigerungen der Gesamtzahl geborener Kinder pro Frau.Ungarn ist eines der prominentesten Beispiele für erfolgreiche Pronatalpolitik. Seit 2012 hat das Land umfassende Familienförderprogramme gestartet. Die Verfassung wurde dahingehend geändert, dass die Ehe explizit geschützt wird, dazu kamen finanzielle Boni bei der Eheschließung, Wohnungsförderungen und erweiterte Kindergeldzahlungen. Zwischen 2012 und 2022 stieg die Fertilitätsrate von 1,25 auf 1,52 Kinder pro Frau.
Auch wenn kritische Stimmen monieren, dass dieser Wert weiterhin unter dem Ersatzniveau liegt und zuletzt leicht rückläufig war, zeigt der Trend eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Zeit vor Einführung der Maßnahmen. Die Programme verfolgen dabei nicht nur das Ziel mehr Kinder zu gebären, sondern unterstützen junge Familien umfassend in ihrer Wohnsituation und wirtschaftlichen Lage – was insgesamt zur Familiengründung ermutigt.Die Mongolei liefert ein weiteres faszinierendes Beispiel für die Wirkung von Geldleistungen auf die Geburtenrate. Dort stieg die Fertilitätsrate von etwa 2,0 Kindern pro Frau im Jahr 2006 auf nahezu 3,0 im Jahr 2014, nachdem Familienleistungen ausgeweitet wurden. Modellrechnungen belegen, dass die Rate ohne diese Maßnahmen auf unter 1,6 gefallen wäre.
Spannend ist insbesondere, dass mit dem Abschwächen und der Wertminderung der Zuschüsse die Geburtenrate erneut zurückging. Dieses Muster verdeutlicht die direkte Wirkung von Geld auf die Familienplanung und macht die Mongolei zu einer der klarsten Demonstrationen der Ursachen-Wirkungs-Beziehung zwischen finanziellen Anreizen und steigenden Geburtenzahlen.Auch kulturell und wirtschaftlich hochentwickelte Länder können von solchen Maßnahmen profitieren. Japan etwa hat ab 2010 seine Familienunterstützung signifikant ausgeweitet. Ohne diese politischen Eingriffe hätte die Fertilitätsrate von etwa 1,4 Kindern pro Frau auf dramatisch niedrige Werte von 0,8 sinken können.
Dank der Maßnahmen konnte das Land das Niveau stabilisieren und mögliche demografische Einbrüche verhindern. Das bedeutet einen 60-prozentigen Vorteil gegenüber einem Szenario ohne staatliche Familienförderung. Dieses Beispiel widerlegt die oft geäußerte These, dass die tiefgreifenden sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen, die Geburtenrückgänge verursachen, nicht mit Geldleistungen beeinflusst werden können. Auch wenn solche Hilfen keine Kehrtwende bewirken, so dämmen sie den Rückgang zumindest deutlich ein.In Mitteleuropa zeigt das Beispiel Tschechien versus Slowakei, wie unterschiedliche Familienförderungen bei sehr ähnlichen kulturellen und wirtschaftlichen Bedingungen zu abweichenden Geburtenraten führen können.
Nach der Trennung der Tschechoslowakei 1993 sank der Familienetat in beiden Ländern zunächst, allerdings schnitt die Tschechische Republik ihre Familienleistungen später wieder auf, die Slowakei kürzte weiter. Die Folge: Tschechische Frauen bekamen im Schnitt mehr Kinder als slowakische. Dies zeigt, wie entscheidend eine verlässliche und großzügige Familienpolitik ist. Diese Politik muss jedoch sowohl finanzielle Komponenten als auch unterstützende gesellschaftliche Rahmenbedingungen umfassen, damit Familienplanung nicht nur ein Wunsch bleibt, sondern auch realisierbar wird.Ein weiterer oft angeführter Punkt ist, dass Geldleistungen lediglich die Geburtstermine verschieben, statt tatsächlich die Familiengröße zu erhöhen.
Während eine gewisse Verlagerung der Geburtszeitpunkte vorkommt, zeigen Studien, dass etwa ein Drittel der Wirkung darin besteht, die Anzahl der Kinder insgesamt zu erhöhen. Frühere Geburten helfen darüber hinaus der Gesundheit von Mutter und Kind, reduzieren medizinische Kosten, erleichtern den Wiedereinstieg ins Berufsleben und ermöglichen einer Gesellschaft, schneller neue Arbeitskräfte hervorzubringen. Ältere Mutter werden öfter mit Komplikationen konfrontiert, was erhebliche zusätzliche Belastungen für Gesundheitssystem und Familien verursacht. Somit sind aktive familienpolitische Maßnahmen auch eine Investition in die Gesundheit und Lebensqualität zukünftiger Generationen.Die ökonomischen Dimensionen der Cash-for-Kids-Strategie sind komplex.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen – wie die Anhebung und Ausweitung des Kindergeldes und der steuerlichen Entlastungen – bedeuten für den Staat zunächst höhere Ausgaben. Die Institute for Family Studies quantifiziert die Kosten entsprechender Vorschläge auf etwa 200 bis 350 Milliarden US-Dollar jährlich. Finanzierungsmöglichkeiten umfassen die Einführung oder Erhöhung spezieller Verbrauchssteuern, beispielsweise auf bestimmte Branchen wie Pornografie, soziale Medien oder Glücksspiel, die hohe Umsätze erzielen, jedoch bislang nur gering besteuert werden. Daneben wären auch eine Reform der Sozialversicherungsbeiträge denkbar, insbesondere die Anhebung oder Abschaffung der bisherigen Beitragsbemessungsgrenzen, um höhere Einkommen stärker zu belasten. Letztlich stehen diesen Aufwendungen langfristig erhebliche Vorteile gegenüber, wie die Stabilisierung der Bevölkerungszahl, Steigerung des Erwerbspersonenpotenzials und das Vermeiden erheblicher Folgekosten bei demografischem Schrumpfen.
Zusammenfassend zeigt die Evidenz deutlich, dass finanzielle Unterstützung von Familien eine wirkungsvolle Maßnahme zur Erhöhung der Geburtenrate ist. Gegensatz zu mancher Meinung führt Geld für Kinder nicht nur zu einem Vorziehen bereits geplanter Geburten, sondern trägt tatsächlich dazu bei, dass Familien mehr Kinder bekommen. Die positiven Effekte reichen dabei weit über reine Geburtenzahlen hinaus. Sie wirken sich auf Gesundheit, Wirtschaft und gesellschaftlichen Zusammenhalt aus. Staaten mit sinkender Bevölkerung sollten daher Familienförderung als strategische Priorität verstehen, die Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und Wohlstand schafft.
Die Forschungsergebnisse des Institute for Family Studies untermauern diesen Ansatz durch internationale Vergleiche und empirische Daten und liefern damit wertvolle Impulse für die künftige Politikgestaltung im demografischen Bereich.