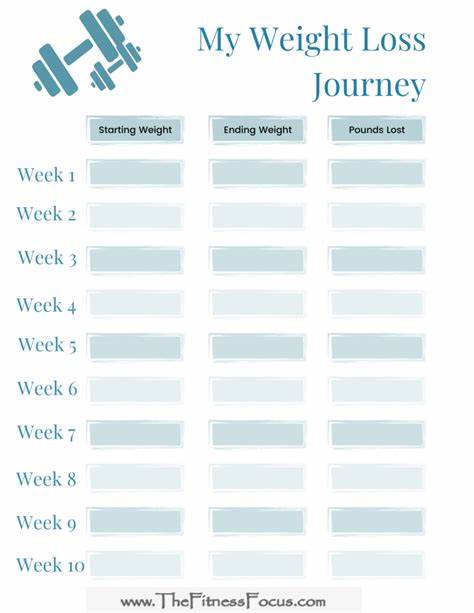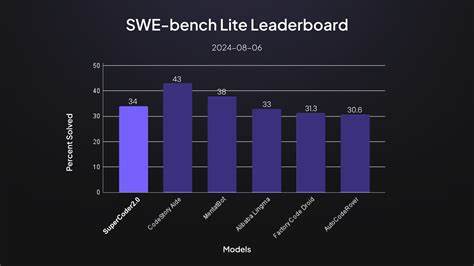Die Welt der Kriminalfälle ist oft von überraschenden Wendungen geprägt, doch kaum jemand hätte vermutet, dass eine App zur Bürgerwissenschaft einmal zum Dreh- und Angelpunkt eines Mordprozesses werden könnte. Dabei ist genau das beim aktuellen Fall der Australierin Erin Patterson geschehen, die beschuldigt wird, drei Menschen mit giftigen Pilzen – den berüchtigten grünen Knollenblätterpilzen (Amanita phalloides) – vergiftet zu haben. Ein elementarer Bestandteil der Beweislage ist die Citizen-Science-App iNaturalist, die auf den ersten Blick wenig mit Kriminalität zu tun zu haben scheint, aber in diesem Prozess eine ungewöhnliche und bedeutende Rolle spielt.iNaturalist wurde vor knapp zwei Jahrzehnten gegründet und hat sich seitdem zu einer der größten Plattformen weltweit entwickelt, auf der Naturliebhaber, Amateurforscher und Wissenschaftler zusammenkommen. Nutzer können Fotos von Pflanzen, Pilzen, Tieren und anderen Naturerscheinungen hochladen, die dann mithilfe von künstlicher Intelligenz und einer engagierten Community identifiziert werden.
Über 240 Millionen Beobachtungen sind mittlerweile in der Datenbank gespeichert, was die App zu einer riesigen Fundgrube für ökologische Forschung, Artenerkennung und Umweltschutz macht. Allein in Australien wurden über 10 Millionen Beobachtungen eingetragen.Was die App besonders macht, ist die Kombination aus einfachem Zugang für jedermann und hoher Datenqualität, die nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch andere Bereiche überraschend nützlich sein kann. Im Fall von Erin Patterson geht es vor allem um jene Funktion, mit der Nutzer die Fundorte ihrer Beobachtungen öffentlich zugänglich machen können. Offenbar soll Patterson iNaturalist genutzt haben, um gezielt Orte aufzuspüren, an denen giftige Todeskappen wachsen – ein Aspekt, der der Anklage seit kurzem als tragendes Beweismittel dient.
Diese Verbindung zwischen einer Citizen-Science-Plattform und einem Gerichtsverfahren wirft viele Fragen auf – nicht nur zu den technischen Möglichkeiten der App, sondern auch zu Datenschutz, Ethik und den Folgen für die Nutzer. Generell sind App wie iNaturalist darauf ausgelegt, Wissen über die Verbreitung heimischer und fremdländischer Arten zu sammeln. Sie helfen, invasive Spezies frühzeitig zu erkennen und fördern das Verständnis für Ökosysteme. Doch die Tatsache, dass Standortdaten öffentlich gemacht werden können, birgt auch Risiken, wie der aktuelle Fall deutlich macht.iNaturalist hat deshalb bereits vor über zehn Jahren Funktionen zur sogenannten Geo-Privatsphäre eingeführt, mit denen Nutzer ihren Standort entweder verschleiern oder nur allgemein angeben können.
Insbesondere gefährdete Arten werden automatisch anonymisiert, um Wilderei und unkontrollierte Menschenansammlungen an besonderen Fundorten zu verhindern. Verdeckte Standorte schützen also seltene Tiere und Pflanzen vor unbefugtem Zugriff und tragen zum Artenschutz bei.Doch selbst mit diesen Maßnahmen bleibt der Schutz der Privatsphäre eine Herausforderung. Fotos enthalten oft Metadaten oder Hinweise im Bildhintergrund, die Rückschlüsse auf den Standort zulassen. Nutzer sind daher angehalten, bei besonders sensiblen Beobachtungen vorsichtig zu sein und möglichst wenig Hintergrundinformationen preiszugeben.
Gerade bei ortsgebundenen Organismen wie Pilzen oder Pflanzen kann eine genaue Ortsangabe durchaus unverzichtbar sein, birgt aber gleichzeitig das Risiko, dass diese Daten missbraucht werden.Im Rahmen der Forensik eröffnet iNaturalist jedoch auch neue Möglichkeiten. Die Wissenschaft kennt schon seit längerem die Bedeutung von Pflanzen, Tieren und Insekten zur Klärung von Tatorten oder dem Todeszeitpunkt – ein Bereich, der als „forensische Botanik“ bekannt ist. Aus einer genauen Kenntnis von Verbreitungsgebieten, Lebenszyklen und ökologischen Bedingungen kann abgeleitet werden, wo und wann ein Verbrechen stattgefunden haben könnte. Daten von iNaturalist können hierbei als wertvolle Ressource dienen, um solche Informationen zu validieren und zu erweitern.
Im Fall von Erin Patterson könnten also nicht nur die iNaturalist-Beobachtungen selbst, sondern auch die damit erfassten Klein- und Mikroorganismen oder Pilzarten Hinweise liefern, weil sie Aufschluss darüber geben, wo sich die Verdächtige möglicherweise aufgehalten hat und wie sie an die giftigen Pilze gekommen sein könnte. Die technische Möglichkeit, öffentlich zugängliche Daten auf diese Weise in polizeilichen Ermittlungen zu nutzen, ist erst am Anfang – die Tragweite und ethische Diskussion wird sich in den kommenden Jahren intensivieren müssen.Doch abseits von Kriminalfällen hat iNaturalist immense Bedeutung für den Umwelt- und Naturschutz. Die gesammelten Daten sind eine wichtige Grundlage, um Lebensräume zu verstehen, gefährdete Arten zu schützen und invasive Tiere oder Pflanzen frühzeitig zu erkennen. In Australien werden beispielsweise Biosecurity-Alarme ausgelöst, wenn ungewöhnliche oder potenziell schädliche Arten außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets gemeldet werden.
Das verstärkt die Arbeit von Behörden und unterstützt schnelle Gegenmaßnahmen.Die Kombination aus Bürgerbeteiligung und wissenschaftlicher Expertise macht iNaturalist zu einem Modell, das viele Bereiche berührt, von Biodiversität über Umweltpolitik bis hin zur digitalen Ethik. Naturbegeisterte weltweit sind eingeladen, ihre Beobachtungen beizutragen und so zum globalen Wissen beizutragen. Dabei bleibt die Herausforderung, das richtige Maß zwischen Transparenz und Datenschutz zu finden.Der Prozess um den mutmaßlichen Pilzmord zeigt, dass selbst scheinbar harmlose Apps unerwartet Einfluss auf gesellschaftliche und juristische Bereiche gewinnen können.
Nutzer sollten sich bewusst sein, dass ihre Daten potenziell auch in andersartigen Kontexten genutzt werden können und dementsprechend mit Bedacht agieren. Gleichzeitig bietet die Technologie neue Chancen für Wissenschaftler und Ermittler, Zusammenhänge zu erkennen, die zuvor verborgen blieben.Insgesamt verdeutlicht der Fall von iNaturalist und Erin Patterson, wie eng Vernetzung, Digitalisierung und Naturerfahrung heute miteinander verwoben sind. Er ist ein Beispiel dafür, wie Citizen Science, die ursprünglich als Werkzeug für Umweltschutz und Forschung entwickelt wurde, auch außerhalb ihrer eigentlichen Domäne relevant wird. Die Balance zwischen Nutzen, Schutz der Privatsphäre und ethischer Verantwortung wird in unserer zunehmend datengetriebenen Welt immer wichtiger – und fordert Nutzer, Entwickler und Gesetzgeber gleichermaßen heraus.
Wer sich heute also für Naturbeobachtungen begeistert und die Welt der Pflanzen, Pilze und Tiere entdecken möchte, findet in iNaturalist ein mächtiges Werkzeug. Doch das Beispiel aus dem Mordprozess mahnt zur Vorsicht und Offenheit für die möglichen Folgen der eigenen Datenfreigabe. Die Natur zu erforschen und zu schützen ist wichtiger denn je – aber sie sichtbar zu machen, bedeutet auch, die Verantwortung für die persönlichen Informationen zu übernehmen.Die Schnittstelle zwischen Natur, Wissenschaft und digitaler Gesellschaft hat mit iNaturalist eine faszinierende neue Dimension erreicht. Ob als Unterstützer des Umweltschutzes, als Forscher oder sogar in der Rechtsmedizin – Citizen Science wird weiterhin überraschende und vielfältige Rollen spielen und unser Verständnis von der natürlichen Welt sowie unserer sozialen Realität erweitern.
Die Geschichte des Pilzmords wird sicherlich noch lange nachhallen und auch anderen Nutzern Impulse geben, wie wertvoll und zugleich sensibel Datensammlungen in der modernen Zeit sind.