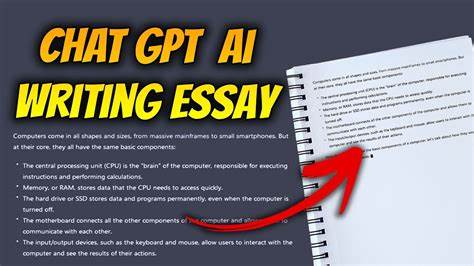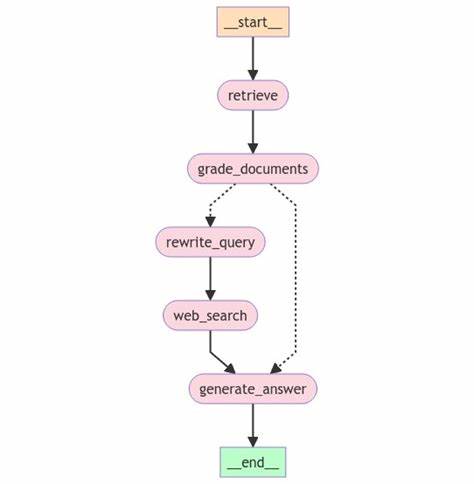Im digitalen Zeitalter, in dem Künstliche Intelligenz immer mehr in den Alltag eindringt, stellt sich häufig die Frage, ob ein Text tatsächlich von einem Menschen geschrieben wurde oder ob eine Maschine dahintersteckt. ChatGPT und ähnliche Sprachmodelle liefern beeindruckende Leistungen und können Texte sehr menschlich wirken lassen. Dennoch haben sie eigenständige Eigenheiten, die sich auf das fertige Werk übertragen und es ermöglichen, sie zu identifizieren. Die genaue Kenntnis dieser Hinweise ist wichtig – sowohl für Leserinnen und Leser, die authentische Inhalte schätzen, als auch für Autorinnen und Autoren, die ihre eigene Stimme bewahren möchten. Der folgende Text beschäftigt sich mit den charakteristischen Merkmalen von ChatGPT-generierten Texten und erläutert, wie sie sich von menschlicher Schreibarbeit unterscheiden.
Ein besonders markantes Merkmal von KI-Texten ist die hochstrukturierte und repetitive Formulierung. ChatGPT tendiert dazu, Phrasen immer wieder in ähnlicher Weise anzuordnen. In Bewerbungsschreiben oder Blogposts lassen sich typische Formulierungen erkennen, die man gefühlt schon unzählige Male gelesen hat. Standardfloskeln wie "Es ist wichtig zu beachten", "Navigieren Sie durch die Komplexitäten von" oder "Basierend auf den vorliegenden Informationen" verraten oft den automatischen Ursprung eines Textes. Diese Phrasen wirken nicht nur unpersönlich, sondern auch wie eine Pflichtübung, bei der der Autor nur vorgegebene Muster aneinanderreiht.
Menschliche Autoren dagegen bringen bewusst Variation in Wortwahl und Satzbau ein und haben einen individuellen Stil, der mit jedem Text zum Ausdruck kommt. Ein weiteres deutliches Zeichen ist der generische Charakter der Inhalte. ChatGPT arbeitet, indem es auf riesige Datenmengen zurückgreift und wahrscheinliche Wortfolgen bildet. Dadurch entsteht häufig ein Ergebnis, das oberflächlich korrekt ist, aber an Tiefe und Originalität vermissen lässt. Die Texte wirken oft banal, eingängig-gleichförmig und enthalten wenig neue Erkenntnisse oder interessante Perspektiven.
So entstehen Passagen, die sich mit Allgemeinplätzen befassen oder banale Ratschläge auflisten, ohne spürbare Leidenschaft oder Detailreichtum. Menschliche Schreiber hingegen füllen ihre Texte mit konkreten Beispielen, persönlichen Anekdoten und einer eigenen Haltung, die beim Lesen fesselt und neugierig macht. Was die Erzählperspektive betrifft, verwenden KI-Texte fast ausschließlich die zweite oder dritte Person. Die Ich-Formingeschichten oder subjektiven Erzählstile sind selten oder wirken künstlich eingefügt. Dies liegt daran, dass die Modelle im Training vor allem auf neutralen, informativen Stil optimiert sind und die Verwendung der Ich-Perspektive komplexer und vom Kontext abhängiger ist.
Dementsprechend bleibt die Stimme in ChatGPT-Texten oft konservativ, sachlich und distanziert, was sie weniger lebendig macht. Menschen tendieren dagegen dazu, im Verlauf eines Textes die Perspektive zu wechseln oder Emotionen einzubringen, damit der Leser einen emotionalen Zugang bekommt. Dieses subtile Wechselspiel trägt stark zu einem dynamischen und natürlichen Leseerlebnis bei. Ebenfalls auffällig ist die unmittelbare Hinwendung zu Listenstrukturen, sobald ein Thema aufgegriffen wird. ChatGPT neigt dazu, Antworten und Erklärungen häufig in Listenform zu präsentieren, auch wenn das Thema eigentlich komplexer oder emotionaler behandelt werden sollte.
Dieses Vorgehen spiegelt die Optimierung auf Übersichtlichkeit wider, wirkt aber in längeren Beiträgen mit Nuancen oft unpassend und wirkt aufgesetzt. Menschliche Autoren hingegen schreiben meist Einführungen oder Kontextualisierungen, erzählen kleine Geschichten und bauen Spannung auf, bevor sie auf konkrete Punkte eingehen. Eine zu schnelle und übermäßige Auflistung von Aspekten kann folglich ein Indiz für KI-Generierung sein. Der Mangel an inhaltlicher Tiefe und Detailgenauigkeit ist häufig ein Problem von ChatGPT-Texten. Da KI-Modelle keine echten Erfahrungen oder Gefühle besitzen, wählen sie meist allgemeine Beispiele aus, scheuen sich davor, spezifische Zahlen, Namen oder sensorische Beschreibungen einzubauen.
Dadurch wirken solche Texte oberflächlich und austauschbar. Das menschliche Erleben hingegen liefert viele sensorische Details, lebendige Metaphern und konkrete Fakten, die das Geschriebene glaubwürdig und plastisch machen. Genau solche Elemente erlauben es dem Leser, sich emotional zu verbinden, was bei reinen KI-Texten deutlich seltener der Fall ist. Eine besondere Eigenart von ChatGPT ist das gehäufte Auftreten von Gedankenstrichen, sogenannten Em-Dashes. Während zuvor häufig lange und stark kommagetrennte Sätze ein Kennzeichen waren, wurde seit Version 4.
0 die Verwendung von Em-Dashes erhöht. Diese langen Gedankenstriche sind stilistisch korrekt, können aber bei übermäßiger Nutzung den Lesefluss stören und einen künstlichen Eindruck hinterlassen. Ein ausgewogenes Verhältnis verschiedener Satzzeichen ist ein Indikator für einen erfahrenen menschlichen Schreiber. Darüber hinaus zeigt sich bei KI-Texten oft eine konsequente Parallelstruktur in Satzbau und Formulierungen. Wiederholte Satzkonstruktionen wie "Es geht nicht nur um X, sondern um Y" fallen besonders auf, da sie scheinbar automatisch generiert und mehrfach im selben Beitrag eingebaut werden.
Diese Art der Parallelismus ist zwar grammatikalisch einwandfrei, wirkt aber schnell monoton und monoton. Menschen dagegen variieren Satzstrukturen bewusst, um Lebendigkeit und Rhythmus zu erzeugen, was einen Text ansprechender macht. Ein besonders menschliches Merkmal ist das Vorhandensein von Fehlern – sei es Rechtschreibfehler, grammatikalische Ungenauigkeiten oder stilistische Unsauberkeiten. Interessanterweise werden solche "Unvollkommenheiten" von Lesern oft als Zeichen von Authentizität wahrgenommen. ChatGPT-Texte sind hingegen nahezu frei von Fehlern und wirken dadurch manchmal steril und überkorrigiert.
Fehler können spontan auftreten, Ausdrücke wirken unverhofft oder Überraschungen im Satzbau lockern den Text auf und machen ihn dynamisch. Diese 'Unregelmäßigkeiten' machen menschliche Texte unverwechselbar. Auch die Satzlänge ist ein guter Indikator. KI-Texte tendieren dazu, durchgängig lange und komplexe Sätze zu bilden oder monotone Satzlängen einzuhalten. Das führt oft zu ermüdenden Passagen und einem staubtrockenen Eindruck.
Menschen kombinieren kurze und prägnante Sätze mit längeren Ausführungen, variieren dadurch die Lesegeschwindigkeit und erzeugen Spannung. Die bewusste Abwechslung trägt maßgeblich dazu bei, dass Texte lebendig und eingängig sind. In Bezug auf Konsistenz fällt bei KI häufig ein Mangel an individueller Handschrift auf. In unterschiedlichen Beiträgen desselben angeblichen Autors schwankt die Stimme stark, der Ton ist mal formell, mal locker, mal distanziert. Diese Inkonsistenz entsteht, weil KI-Modelle keine Persönlichkeit besitzen und sich stilistisch am Input orientieren.
Bei Menschen dagegen erkennen aufmerksame Leser bestimmte Schreibmuster, wiederkehrende Formulierungen oder eine charakteristische Tonalität, die den Wiedererkennungswert erhöht und Vertrauen schafft. Ein weiteres Merkmal ist die übermäßige Verwendung von vorsichtigen Formulierungen und das sogenannte "Hedging". ChatGPT vermeidet definitive Aussagen, um nicht falsche oder kontroverse Informationen zu verbreiten. Dadurch kommen häufig Wörter und Phrasen wie "typischerweise", "könnte sein", "nicht immer" zum Einsatz, die den Eindruck von zögerlicher oder unsicherer Haltung vermitteln. Menschen hingegen geben oft klare Meinungen ab, setzen Kontraste oder drücken persönliche Überzeugungen aus, was Texte kraftvoller und fesselnder macht.
Sogar in den Titeln finden sich Hinweise auf automatisierte Erstellung. Die Verwendung von Doppelpunkten, um Titel in zwei Teile zu gliedern, hat in der KI-zeit stark zugenommen. Titel wie "XYZ: So gelingt Ihnen ABC" sind beliebt bei ChatGPT, da diese Form gut zur Strukturierung passt, aber auch häufig zu übertriebener Formalität und Eingängigkeitsstrategie führt. Während Menschen natürlich solche Titel wählen können, ist deren Wiederholung im gleichen Stil oft ein Zeichen für KI-Generierung. Nicht zuletzt übersäen KI-Texte das Geschehen mit bekannten Blogging-Klischees und Floskeln.
Phrasen wie "Es geht ohne Zweifel darum", "Haben Sie sich jemals gefragt?", "Jetzt fragen Sie sich vielleicht" oder "Jeder möchte unbedingt" sind Standardbausteine, die bei den Sprachmodellen besonders häufig auftreten. Da sie auf Millionen bestehender Texte trainiert sind, spiegeln sie diese stereotypen Wendungen wider, wodurch der Text schnell oberflächlich und unoriginell wirkt. Authentische menschliche Autoren vermeiden solche Konstruktionen oder setzen sie bewusst ironisch ein. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Erkennung von Texten, die mit ChatGPT verfasst wurden, vor allem auf einer Kombination verschiedener Anzeichen beruht. Einzelne Aspekte allein sind kein zwingender Beweis, aber zusammengenommen entsteht ein klares Bild.