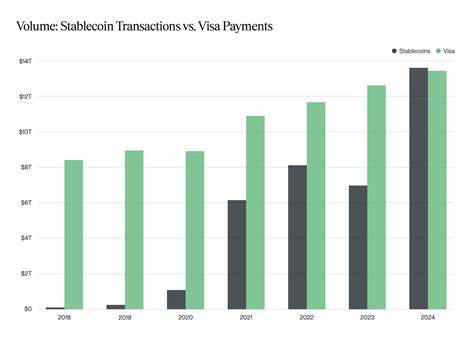In der Welt der Softwareentwicklung hat sich in den letzten Jahren eine lebhafte Debatte um die optimale Architektur von Anwendungen entwickelt. Die Diskussion zwischen Microservices und Monolithen ist dabei besonders präsent. Doch immer mehr Stimmen plädieren dafür, dass diese Gegenüberstellung eine falsche Dichotomie darstellt. Ein innovativer Ansatz, der genau diese Lücke schließt, ist die sogenannte Rider und Elephant Architektur. Diese Herangehensweise verspricht eine Kombination der besten Eigenschaften beider Welten: die Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit von Microservices und die einfache Wartung sowie Produktivität eines Monoliths.
Der Name dieser Architektur leitet sich von einer bekannten Metapher aus der Psychologie ab und beschreibt spielerisch das Zusammenspiel zweier unterschiedlicher, aber unbedingt kooperierender Komponenten. Inspiriert von Sigmund Freuds Konzept des Ichs, Über-Ichs und Es oder von neueren Vorstellungen, in denen das menschliche Gehirn als Zusammenspiel eines leistungsstarken, aber unkontrollierten Elefanten und eines lenkenden Reiters gesehen wird, illustriert die Architektur genau dieses Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Power. Dabei repräsentiert der „Elephant“ eine Komponente, die enorme Rechenleistung und Stärke besitzt, jedoch keine eigene Intelligenz im Sinne von Geschäftslogik mitbringt. Er ist der Arbeitspferd im System und führt datenintensive, ressourcenintensive und häufig wiederholbare Aufgaben mit hoher Effizienz durch. Im Gegensatz dazu ist der „Rider“ die Steuerungseinheit, die mit Geschäftslogik, Datenbankzugriffen und der Koordination des Gesamtsystems betraut ist.
Er führt die Fäden in der Hand und stellt sicher, dass die Abläufe logisch und zielgerichtet bleiben. Am Beispiel von DealGate, einem führenden Unternehmen im Bereich B2B-Lead-Generierung, wird dieses Architekturmodell eindrucksvoll umgesetzt. Ihre Hauptanwendung basiert auf NextJS, einem JavaScript-Framework, das für Webanwendungen sehr produktiv und flexibel ist, jedoch in bestimmten Szenarien aufgrund seiner Single-Threaded-Natur an seine Leistungsgrenzen stößt. Vor allem bei der parallelen Verarbeitung von Millionen von regulären Ausdrücken und der massenhaften Bild- und PDF-Verarbeitung stößt man auf Engpässe. Um diese Herausforderungen zu meistern, setzt DealGate für diese rechenintensiven Aufgaben auf die Programmiersprache Go (Golang).
Die Go-Anwendung fungiert als „Elephant“ – sie ist hoch performant, unterstützt Tausende von gleichzeitig laufenden Goroutinen und kann anspruchsvolle, parallele Datenverarbeitungsaufgaben ohne Einschränkungen bewältigen. Dabei übernimmt das Go-System selbst keine Geschäftslogik, sondern dient ausschließlich als „dummer Arbeiter“ zum schnellen und effektiven Bearbeiten der Aufgaben. Der „Rider“ hingegen, das NextJS-Frontend mit der zugehörigen Backend-Logik, orchestriert die Abläufe und steuert, wann und wie der Elephant seine Leistung abrufen soll. Es enthält alle geschäftskritischen Prozesse wie Benutzerverwaltung, Datenbankoperationen und die API-Schnittstellen zum Frontend. Durch diese klare Arbeitsteilung werden Engpässe in der Performance vermieden, während gleichzeitig eine hohe Entwicklerproduktivität gewährleistet bleibt.
Dieses Modell hebt auch einen wichtigen Aspekt hervor, der gerade in Microservice-Architekturen oft unterschätzt wird: die Kommunikation. Zwischen den Komponenten „Elephant“ und „Rider“ wird bei DealGate gRPC genutzt, ein leichtgewichtiger und effizienter Kommunikationsprotokoll-Stack, der die Overhead-Kosten für das Senden und Empfangen von Daten stark minimiert. Die Übertragung großer Datenmengen in hochfrequenten Interaktionen wäre mit traditionellen JSON-basierten Schnittstellen schlichtweg ineffizient und würde die Leistungsfähigkeit reduzieren. Die Diskussion um die Wahl der Programmiersprache für komplexe Anwendungen ist eng mit diesem Architekturkonzept verbunden. Obwohl es verlockend erscheinen mag, einfach ausschließlich Hochleistungssprachen wie Rust oder C++ zu verwenden, spielt die Kosten-Nutzen-Relation eine entscheidende Rolle.
Hohe Programmiersprachen sind sicherer und deutlich produktiver, verfügen über größere Entwickler-Communities und ermöglichen schnellere Entwicklungszyklen. Gerade für Unternehmen, die nicht ausschließlich auf rechenintensive Anwendungen fokussiert sind, macht es wenig Sinn, alle Komponenten in einer ressourcenintensiven und komplexen Sprache zu implementieren. Die Rider und Elephant Architektur adressiert genau diese Herausforderung. Sie erlaubt es, den „Elephant“ in einer Hochleistungssprache zu implementieren, während der „Rider“ in einer höher entwickelten, einfacher zu wartenden und häufig asynchronen Sprache wie JavaScript, Python oder TypeScript geschrieben wird. Dadurch kombiniert dieses Modell eine minimale Menge an komplexem, ressourcenlastigem Code mit einer maximierten Menge an effizient wartbarem und entwicklerfreundlichem Code.
In Zeiten, in denen viele große Unternehmen wie Amazon Prime von Microservices zurück zu Monolithen wechseln, erhält die Rider und Elephant Architektur besondere Relevanz. Sie bietet eine pragmatische Option zwischen dem hohen Wartungsaufwand verteilter Microservice-Architekturen und der eingeschränkten Skalierbarkeit großer Monolithen. Gerade in Szenarien mit massivem Datenvolumen und gleichzeitigem Bedarf an schneller Entwicklung und Flexibilität bringt dieser Ansatz entscheidende Vorteile. Ein wesentlicher Vorteil ist die einfachere Wartung. Da der Elephant keine Geschäftslogik enthält, können Updates und Änderungen an der Datenverarbeitung unabhängig von den Kernprozessen des Systems umgesetzt werden.
Gleichzeitig entfällt die komplexe Verwaltung zahlreicher in sich abgeschlossener Microservices mit ihren eigenen Datenbanken, Schnittstellen und Abhängigkeiten. Die mentale Last für Entwickler und Betriebsverantwortliche wird damit reduziert. Darüber hinaus ermöglicht die Architektur eine klare Fokussierung auf Performance dort, wo sie wirklich nötig ist. Entwickler müssen nicht jeden Teil der Anwendung in einer schwereren Hochleistungssprache schreiben, sondern können effizient die Stärken beider Welten nutzen. So entsteht ein ausgewogenes Gleichgewicht aus Produktivität, Performanz und Wartbarkeit.
Diese Architektur ist jedoch kein Allheilmittel. Wie bei allen Softwarearchitekturen gilt auch hier: Es gibt keine perfekten Lösungen, sondern nur Kompromisse. Der Erfolgsfaktor liegt in der bewussten Auswahl, welche Teile der Anwendung als „Elephant“ ausgegliedert werden und welchen Anforderungen sie genügen müssen. Gleichzeitig muss die Schnittstelle zwischen „Elephant“ und „Rider“ so ausgelegt sein, dass sie maximalen Datentransfer mit minimalem Overhead ermöglicht. Für Unternehmen, die große Datenmengen verarbeiten, komplexe Berechnungen durchführen oder mit vielen gleichzeitigen parallelen Prozessen arbeiten, bietet das Rider und Elephant Modell eine attraktive Alternative.
Anders als klassische Microservices setzt es nicht auf eine Vielzahl von kleinsten eigenständigen Diensten, sondern auf eine klare Zweiteilung funktionaler Schwerpunkte. Dies erleichtert die Skalierung und senkt den organisatorischen Aufwand bei gleichzeitiger hoher Durchsatzleistung. Auf der anderen Seite eignet sich dieses Modell weniger für kleine Anwendungen oder Projekte, die keine komplexen, parallelisierten Verarbeitungslasten bewältigen müssen. Hier kann die Implementierung eines Monolithen in einer hohen Programmiersprache wie JavaScript oder Python weiterhin ausreichend und ökonomisch sein. Die Kombination aus Go als Elefanten und NextJS als Reiter hat in der Praxis gezeigt, dass dieser architektonische Ansatz zu hoher Stabilität, besseren Performance-Werten und einer angenehmen Entwicklungsumgebung führt.
Die Möglichkeit, sowohl das beste Werkzeug für die Datenverarbeitung als auch für die Business-Logik einzusetzen, macht den Unterschied. Die Architektur adaptiert Schlüsselprinzipien der Trennung von Verantwortlichkeiten und optimiert sie für die Realität moderner Webanwendungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rider und Elephant Architektur im Jahr 2024 eine relevante und frische Perspektive auf die Gestaltung verteilter Anwendungen bietet. Sie bricht mit traditionellen Denkmustern, die Monolithen und Microservices gegeneinander ausspielen, und schafft einen Mittelweg, der technische Exzellenz mit ökonomischer Effizienz verbindet. Unternehmen, die vor der Herausforderung stehen, große Datenmengen performant zu verarbeiten, ohne dabei die Wartbarkeit und Geschwindigkeit der Entwicklung zu opfern, sollten diesen Ansatz unbedingt prüfen.
Mit dem Blick auf die Zukunft wird die Rider und Elephant Architektur vermutlich noch weiter an Bedeutung gewinnen. In einer Welt, in der Softwareprojekte immer komplexer werden und gleichzeitig schneller geliefert werden müssen, sind pragmatische und effiziente Architekturen gefragt. Dieses Modell bietet genau das: die smarte Symbiose aus Rechenpower und intelligenter Steuerung, die alte Gegensätze überwindet und eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Softwarekomponenten ermöglicht.