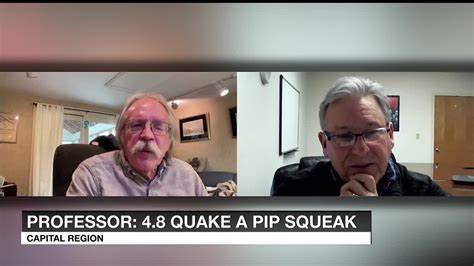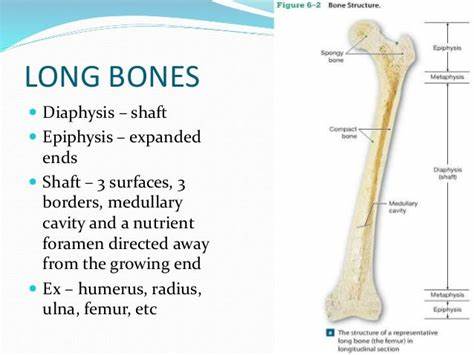Die Bandai Pippin ist eine der ungewöhnlichsten Konsolen, die jemals auf den Markt gebracht wurden. Entstanden aus einer Zusammenarbeit zwischen Apple und Bandai im Jahr 1995, war die Pippin als Multimedia-Plattform konzipiert, die Computer- und Konsolenerlebnisse miteinander verschmelzen sollte. Trotz ihrer damals innovativen Ausrichtung blieb die Pippin kommerziell erfolglos, was sie heute zu einem begehrten Sammlerstück macht. Eine der bemerkenswertesten Demonstrationen ihrer Fähigkeiten ist jedoch, dass sie in der Lage ist, den legendären Ego-Shooter Quake zum Laufen zu bringen – eines der einflussreichsten Spiele der 1990er Jahre. Doch wie funktioniert Quake auf der Pippin, und welche Herausforderungen mussten überwunden werden, um das Spiel überhaupt spielbar zu machen? Um diese Fragen zu beantworten, lohnt sich ein tiefer Einblick in die technischen Details und die Besonderheiten der Pippin-Architektur sowie der Mac-Portierung von Quake.
Quake, ursprünglich 1996 von id Software veröffentlicht, setzte einen neuen Standard für 3D-Grafik und Gameplay auf PC-Plattformen. Die Version, die auf der Pippin läuft, ist ein Mac-Port von Lion Entertainment aus dem Jahr 1997, der in der Version 1.08.4 zur Verfügung steht. Diese Version ist insofern bedeutsam, als dass Nachfolgeversionen (wie 1.
09) bekannte Probleme mit dem Sound haben, und Version 1.08.5 derzeit kaum zugänglich ist. Die Herausforderung bestand darin, Quake so auf der Pippin zum Laufen zu bringen, dass das Spiel nicht nur startet, sondern auch mit vertretbarer Performance spielbar ist. Die Pippin basiert technisch auf einem PowerPC 603 Prozessor und läuft unter einem angepassten System 7.
5.2 Betriebssystem, genannt Pippin OS. Im Gegensatz zu klassischen Mac-Systemen mit System 7.5.3 oder höher fehlen der Pippin bestimmte wichtige Systembibliotheken, die für Quake unabdingbar sind.
Die Systembibliotheken sind ein wesentliches Element des Macintosh-Betriebssystems, das den Anwendungen grundlegende Funktionen bereitstellt. Für Quake bedeutete das Fehlen dieser Bibliotheken, dass das Spiel nicht einmal startete, sondern stattdessen Fehlermeldungen ausgab. Deshalb war es nötig, die minimale Systemumgebung der Pippin so zu erweitern, dass sämtliche für Quake erforderlichen Komponenten vorhanden waren. Zu den wichtigsten Erweiterungen gehört die Display Library. Diese Bibliothek ermöglicht es, die Bildschirmauflösung dynamisch zu wechseln, was für Mac OS 7.
5.3 und neuere Versionen typischerweise integriert ist. Da die Pippin allerdings nur eine feste Bildschirmauflösung von 640×480 Pixeln bietet und mit System 7.5.2 arbeitet, musste die Display Library extern bereitgestellt werden, um die Link-Abhängigkeiten von Quake zu befriedigen.
Ohne diese Bibliothek verweigerte Quake den Start. Ebenso kritisch ist die ObjectSupportLib, die in Mac OS 8 und späterer Version standardmäßig enthalten ist. Sie erlaubt die Unterstützung von Apple Events und AppleScript-Objekten. Quake nutzt diese Funktionalität, um eine Konsole per AppleScript zu steuern. Obwohl viele Spieler diese Funktion möglicherweise nicht aktiv nutzen, ist die Bibliothek eine Voraussetzung für den Programmstart.
Eine weitere wichtige Komponente ist InputSprocketLib, ein Teil von Apples Game Sprockets-Sammlung. Diese Schnittstelle dient der Eingabegeräteerkennung und Eingabeverwaltung, etwa für Joysticks oder Mausersatzgeräte. Quake erfordert diese Bibliothek für das Handling der Mausbewegungen und Maustasten, auch wenn das Hauptmenü damit einige Schwierigkeiten bereitet, was gleich noch genauer erläutert wird. Der besondere Dreh an der Pippin ist der Controller, der sogenannte AppleJack. Er kombiniert 13 programmierbare Tasten mit einem Trackball und soll die Steuerung von Spielen ermöglichen.
Die Steuerung von Quake mithilfe dieses Controllers erforderte jedoch komplexe Umwege, denn die Mac-Version von Quake unterstützt nicht alle Funktionalitäten von InputSprocket für Menüaktionen. So ist ohne Maus oder Tastatur die Navigation durch die Menüs nicht möglich, da die InputSprocket-Bindungen für den Controller nur auf In-Game-Aktionen begrenzt sind. Das bedeutet, dass für das Starten eines Spiels zwingend ein Keyboard oder eine Maus angeschlossen sein muss, wenn der Controller InputSprocket gesteuert wird. Um dieses Dilemma zu umgehen, wurde die AppleJack-Erweiterung genutzt, die die 13 Tasten des Pippin-Controllers in eine Tastaturemulation umsetzt. Dadurch kann der Controller als Tastatur simulieren, sodass Quake die Menüs bedienen kann, ohne auf InputSprocket bei der Eingabe angewiesen zu sein.
Allerdings geht dabei die Nutzung des Trackballs als Maus verloren, was eine native Steuerung im Spiel unnötig erschwert. Aufgrund dessen wurde die Steuerung so angepasst, dass sie den Standardtastenbelegungen von Quake entspricht und möglichst intuitiv auf dem Controller funktioniert. So wurden beispielsweise das Bewegen und Drehen über das Steuerkreuz mit den Pfeiltasten verknüpft, während Tasten für Aktionen wie Angriff, Springen und Waffenwechsel festgelegt wurden. Technisch betrachtet hat die Pippin einen Videochip namens „Taos“, der in einem 32-Bit-Bus mit der CPU kommuniziert. Interessanterweise ist das Zugriffsverhalten auf den Videospeicher so ausgelegt, dass der Schreibaufwand für einen 8-Bit-Pixel genauso hoch ist wie für zwei oder vier nebeneinanderliegende Pixel.
Das bedeutet, dass Spiele wie Quake auf der Pippin horizontal eine Pixelverdopplung umsetzen können, ohne dabei Performance einzubüßen. Anstatt also nur 320 Pixel breit zu rendern, lässt sich das Bild effektiv auf die volle Breite von 640 Pixeln strecken. Vertikal wird die Auflösung typischerweise auf den Faktor zwei skaliert, wobei jedoch auf gerenderte Scanlinien verzichtet wird, um Rechenleistung zu sparen. Durch diesen Trick entstehen zwar teilweise Lücken im Bild, aber die Hardware des Taos-Chips wirkt diesen Effekten durch eine Art Weichzeichnung entgegen, sodass das Bild für den Betrachter relativ homogen erscheint. Dieses Verfahren sorgt dafür, dass Quake trotz Hardware-Beschränkungen auf der Pippin ein akzeptables Erscheinungsbild liefert.
Der Speicher ist ebenfalls eine kritische Ressource. Quake brachte offiziell als Mindestanforderung 16 Megabyte RAM mit, doch die Mac-Version erwies sich als flexibler. In der Praxis ist ein Heap von mindestens circa 5,3 Megabyte nötig, das Spiel braucht aber zusätzlich noch anderen Arbeitsspeicher, sodass ein System mit etwa 12 Megabyte Gesamtspeicher ausreichend ist, um Quake zum Laufen zu bringen. Die Pippin verfügt in manchen Ausstattungsvarianten über 8 Megabyte RAM, mit denen sie insgesamt etwa 13 Megabyte adressieren kann. Damit ist es möglich, Quake auf der Pippin zu spielen, auch wenn die Performance darunter leidet.
Der Spielablauf ist nicht ganz flüssig, erreicht aber dennoch eine Bildwiederholrate, die mit einem 486-Prozessor mit 66 MHz vergleichbar ist – eine respektable Leistung für die Hardware einer Multimedia-Konsole der mittleren 1990er Jahre. Im direkten Vergleich zu modernen Systemen oder gar klassischen PCs ist die Performance auf der Pippin nicht imposant, doch die Tatsache, dass Quake überhaupt spielbar ist, spricht für die technische Raffinesse der Portierung und die Flexibilität des Pippin-Systems. Die Soundfunktion blieb dabei aus Performance- und Stabilitätsgründen deaktiviert, da die Version 1.08.4 Sound fehlerfrei unterstützt, während spätere Versionen mit Soundproblematiken zu kämpfen haben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsetzung von Quake auf der Bandai Pippin eine interessante Kombination aus technischer Kreativität und Pragmatismus darstellt. Die größte Herausforderung bestand darin, die Systemumgebung so zu ergänzen, dass Quake ohne Abstürze startet und gespielt werden kann, ohne die native Hardware der Pippin zu überfordern. Dabei mussten fehlende Bibliotheken ergänzt, eine Tastaturemulation mittels AppleJack installiert und Kompromisse bei der Eingabesteuerung eingegangen werden. Die cleveren Kniffe bei der Bildwiedergabe machten eine optisch ansprechende Darstellung bei akzeptabler Performance möglich, sodass die Pippin als Plattform für Quake überraschend gut funktioniert – wenn auch mit Einschränkungen. Für Liebhaber von Retro-Gaming und Apple-Hardware stellt „Pip’s Quake“ damit ein faszinierendes Beispiel dar, wie sich Software jenseits ihrer ursprünglichen Zielplattformen adaptieren lässt.
Obwohl die Pippin selbst ein kurzes Kapitel im Konsolengeschäft war, zeigt das Projekt, wie wertvoll solch eine Nische sein kann, wenn man Technik, Leidenschaft und Know-how verbindet. Es ist durchaus vorstellbar, dass in Zukunft optimierte Source-Ports oder alternative Eingabemöglichkeiten die Spielerfahrung weiter verbessern und Quake auf der Pippin sogar noch zugänglicher machen könnten. Wer also einen funkelnden Blick in die Vergangenheit und eine einzigartige Herausforderung suchen möchte, kann mit der Kombination aus Bandai Pippin und Quake ein technisch und historisch spannendes Erlebnis entdecken, das verdeutlicht, wie vielfältig die Geschichte der Videospiele ist und wie kreative Menschen selbst ungewöhnliche Plattformen zum Leben erwecken.