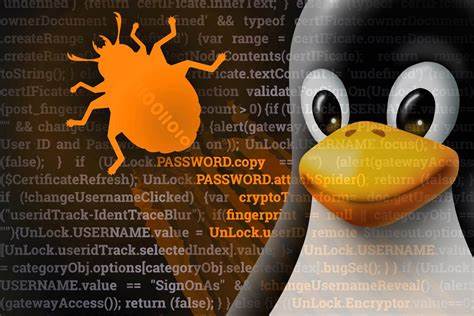Zugriffskontrolle, insbesondere die Autorisierung, steht im Zentrum moderner Softwareentwicklung. Mit wachsender Komplexität von Anwendungen und steigenden Nutzeranforderungen entfaltet sich ein Wandel darin, wie Entwickler Berechtigungen definieren, verwalten und ausführen. Um dieser Entwicklung auf den Grund zu gehen, wurden mehr als 200 Entwickler befragt, die aktiv Zugriffskontrollsysteme bauen und skalieren. Die Ergebnisse geben einen wertvollen Einblick in gegenwärtige Praktiken, Vorlieben und die Erwartungen an die Zukunft der Autorisierung im Jahr 2025. Die dominierende Rolle von RBAC lässt sich auch heute kaum zerstreiten.
Mehr als 94 Prozent der befragten Entwickler haben Role-Based Access Control (RBAC) bereits eingesetzt, und fast 87 Prozent gaben an, dass ihre Plattformen noch immer hauptsächlich auf diesem Modell basieren. RBAC hat sich über lange Zeit als Standard etabliert. Es ist einfach zu verstehen, in der Umsetzung vergleichsweise unkompliziert und wird von den meisten Identitätsanbietern und Management-Werkzeugen unterstützt. Die weite Verbreitung resultiert auch daraus, dass Entwickler oft gezwungen sind, individuelle Lösungen von Grund auf neu zu entwickeln – rund 62 Prozent der Teilnehmer geben an, eine eigene Inhouse-Lösung zur Autorisierung gebaut zu haben. Dies zeigt, dass der marktübliche Werkzeugkasten oft nicht nahtlos zu den spezifischen Architektur- oder Workflow-Anforderungen passt.
Gerade bei verteilten Systemen oder Microservices-Architekturen, die von knapp 60 Prozent der Entwickler genutzt werden, stößt die einfache Rollenzuordnung oft an Grenzen. Die Rolle von RBAC in solchen Umgebungen erweist sich als unübersichtlich und wartungsintensiv, wenn Zugriffsrechte über verschiedene Services hinweg verknüpft werden müssen. Trotz der Schwächen bleibt RBAC eine bewährte und vertraute Basis, auf der viele Teams aufbauen, da sie mit geringen Ressourcen eine zuverlässige Zugriffsverwaltung garantieren wollen. Ein aufkommender Trend zeigt sich hingegen bei modernisierten und komplexeren Zugriffsmodellen, welche deutlich mehr Flexibilität ermöglichen. Attribute-Based Access Control (ABAC) erfreut sich größer werdender Beliebtheit.
Bereits über 41 Prozent der Befragten haben dieses fein granularere Modell angewandt. ABAC ermöglicht eine erweiterte Steuerung, indem neben Rollen auch Eigenschaften von Benutzern, Ressourcen oder der Umgebung als Zugriffsparameter genutzt werden. Dadurch lassen sich Berechtigungen wesentlich kontextsensitiver modellieren, ohne das bestehende RBAC-Fundament komplett zu verwerfen. Dies macht ABAC für viele Teams zu einer praktischen Erweiterung ohne großen Aufwand. Auch Relationship-Based Access Control (ReBAC) gewinnt an Bedeutung.
Mehr als ein Viertel hat Erfahrungen mit diesem Modell gesammelt. Durch die Inspiration von Konzepten wie Google Zanzibar und Technologien wie OpenFGA entstehen Möglichkeiten, Zugriffsrechte dynamisch anhand von Beziehungen und Verknüpfungen zwischen Nutzern und Objekten zu verwalten. ReBAC steht dabei nicht als Ersatz für RBAC, sondern ergänzt dieses um Beziehungsdimensionen. So können die bewährten Rollen beibehalten werden, während komplexe Interaktionen wie Teamzugehörigkeiten oder projektbezogene Rechte flexibel abgebildet werden. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass Entwickler nach Erweiterungen suchen, die das Bekannte nicht ersetzen, sondern verbessern.
Systeme, die Kompositionen aus RBAC, ABAC und ReBAC zulassen, kommen dem natürlichen Wachstum moderner Anwendungen am besten entgegen. Dies entspricht dem Bedürfnis, vielseitige Zugriffsregeln mit möglichst geringem Mehraufwand umzusetzen. Trotz des Innovationsschubs gibt es noch zahlreiche Herausforderungen. Über die Hälfte der Entwickler hat noch keine der etablierten Policy-Sprachen wie Rego, Cedar oder Alfa/XACML verwendet. Die durchschnittliche Zugänglichkeit dieser Sprachen wird mit einer niedrigen Bewertung von 6,1 auf 10 als eher abschreckend empfunden.
Der Grund liegt dabei nicht nur in der nötigen Einarbeitung, sondern auch in der mangelnden Integration der Policy-Sprachen in bestehende Entwickler-Workflows. Viele Entwickler bevorzugen deshalb Werkzeuge, die in ihrer Bedienung und Konfiguration enger an vertraute Umgebungen wie deklarative SDKs, APIs oder Infrastruktur-Werkzeuge wie Terraform angelehnt sind. No-Code-Interfaces oder visuelle Policy-Editoren gewinnen zunehmend an Attraktivität, da sie die Einstiegshürde weiter senken. Ein weiteres großes Problemfeld ist die seltene Nutzung von Echtzeit-Autorisierungsentscheidungen. Mehr als 55 Prozent der Befragten setzen nach wie vor auf statische Evaluationen, bei denen Berechtigungsprüfungen im Voraus getroffen und Zwischenergebnisse gespeichert werden.
In komplexen, dynamischen oder mehrmandantenfähigen Systemen kann dies jedoch fatale Sicherheitsrisiken bergen. Die Umsetzung von just-in-time Autorisierungschecks gilt vielen Teams als entweder zu schwer oder zu ressourcenintensiv. So führt der Verzicht auf Echtzeitentscheidungen oft zu starren Modellen mit begrenzter Anpassungsfähigkeit. Auch das Thema feingranulare Delegation wird nur selten zufriedenstellend gelöst. Weniger als ein Viertel der Entwickler unterstützt die Möglichkeit, Zugriffsrechte selbständig oder durch Repräsentationen auf detaillierter Ebene weiterzugeben.
41 Prozent beschränken sich auf Rollenzuweisungen, was in produkt- oder nutzerorientierten Anwendungen oft nicht ausreichend flexibel ist. Aufgaben wie Zugriffsfreigaben für einzelne Ressourcen oder eingeschränkte Rechteübertragungen erfordern meist individuelle Logik, die im Anwendungscode verankert wird. Dies ist nicht nur wartungsintensiv, sondern schränkt auch die Skalierbarkeit und Sicherheit ein. Der Blick auf die Zukunft offenbart jedoch einen klaren Trend. Über die Hälfte der Entwickler plant, innerhalb des nächsten Jahres feingranulare Autorisierungslösungen zu implementieren.
Dieses Interesse reflektiert eine wachsende Erkenntnis, dass Zugriffssteuerung mehr als eine technische Infrastrukturaufgabe ist und einen maßgeblichen Einfluss auf das Nutzererlebnis hat. Features wie kontextabhängige Berechtigungen, Abstimmungsprozesse oder datengetriebene Sicherheitsmechanismen gewinnen an Bedeutung und setzen flexiblere Systeme voraus. Im Bereich der Monetarisierung spielt die Zugriffskontrolle bislang eine untergeordnete Rolle. Lediglich 12 Prozent der Entwickler geben an, dass Zugriffsrechte als Bestandteil eines kostenpflichtigen Angebots genutzt werden. Die Mehrheit inkludiert sie in allen Produktversionen.
Dies weist darauf hin, wie komplex und kostspielig eine saubere Umsetzung leistungsfähiger Autorisierungsfunktionen in Premium-Features ist. Dennoch gibt es enormes Potenzial, mit externen Lösungen, die feingranulare Zugriffe erleichtern, neue Einnahmemodelle besonders im B2B-Sektor zu erschließen. Dementsprechend ist die Bereitschaft zum Einsatz von Software-as-a-Service (SaaS)-basierten Authorisierungstools beachtlich hoch. Drei Viertel der Befragten würden auf solche Anbieter zurückgreifen, anstatt eigene Systeme weiter auszubauen. Damit folgt die Zugriffskontrolle einem Trend, der sich bereits bei anderen kritischen Infrastrukturkomponenten wie Monitoring, CI/CD oder Authentifizierung etabliert hat.
Entwickler wünschen sich Tools, die leistungsfähig, flexibel und gleichzeitig nahtlos in bestehende Entwicklungslandschaften integrierbar sind. Zusammenfassend zeigt sich, dass die klassische RBAC-basierte Zugriffskontrolle zwar ihre dominante Stellung behält, jedoch zunehmend an Grenzen stößt. Die Zukunft gehört Systemen, die RBAC mit ABAC und ReBAC kombinieren und so ein vielschichtiges, flexibles und feingranulares Berechtigungsmanagement ermöglichen. Darüber hinaus wächst der Bedarf an zugänglichen Policy-Sprachen und Echtzeitprüfungen, um dynamischen Anwendungsszenarien gerecht zu werden. Die Herausforderungen in Sachen Delegation, Performance und Bedienfreundlichkeit unterstreichen, wie weitreichend die Ansprüche an moderne Zugriffskontrolle inzwischen geworden sind.
Entwickler fordern Lösungen, die nicht das Gefühl vermitteln, ihre Arbeit zu erschweren, sondern die vielmehr reibungslos in ihre Abläufe integriert werden können und mit dem Produkt mitwachsen. In einer Welt, in der Benutzererfahrung und Sicherheit gleichermaßen an Bedeutung gewinnen, rückt die Autorisierung immer mehr in den Fokus als zentrales Produktmerkmal. Der Wandel ist nicht mehr aufzuhalten. Wer jetzt auf zeitgemäße, flexible und einfach zu handhabende Zugriffskontrollsysteme setzt, wird für die kommenden Herausforderungen bestens gerüstet sein und Wettbewerbsvorteile erzielen. Die Erkenntnisse der Umfrage machen deutlich, dass Entwickler bereit sind, vom Selbstbau wegzugehen und auf externe, spezialisierte Tools zu setzen, die eine moderne Zugriffskontrolle als Dienstleistung anbieten.
Plattformen wie Permit.io zeigen exemplarisch, wie sich RBAC, ABAC und ReBAC mittels APIs, SDKs und Infrastrukturcode in bestehende Systeme integrieren lassen – mit dem Ziel, den Fokus auf die Produktinnovation zu legen und die komplexe Verwaltung von Berechtigungen an Experten zu übergeben. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Zukunft der Zugriffskontrolle vielschichtig, dynamisch und von der Bereitschaft zur Zusammenarbeit geprägt sein wird. Entwickler suchen nach Lösungen, die flexibel genug sind, um mit komplexen Anforderungen mitzuwachsen, und gleichzeitig einfach zu bedienen sind. Die Zeit, in der Autorisierung als lästige Backend-Aufgabe betrachtet wurde, geht zu Ende.
Stattdessen entsteht ein Bewusstsein dafür, dass sie ein Schlüssel zur Benutzerzufriedenheit, Sicherheit und Skalierbarkeit moderner Anwendungen ist.