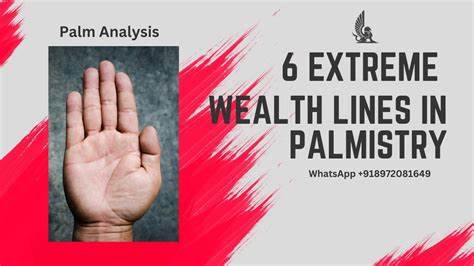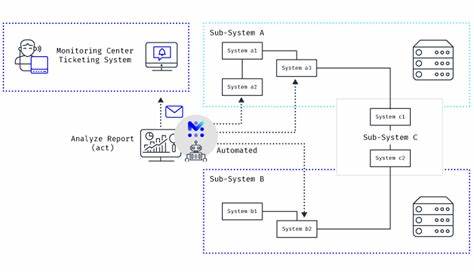Die Diskussion um Armut und ihr Einfluss auf das gesellschaftliche Wohl ist seit langem etabliert. Das Konzept der Armutsgrenze – also die Mindesthöhe an Einkommen oder Ressourcen, die benötigt werden, um ein menschenwürdiges Leben zu führen – ist allgemein anerkannt. Doch in einer Ära, die von der rasant zunehmenden Ungleichheit im globalen Vermögen geprägt ist, gewinnt eine kontrastierende Frage zunehmend an Bedeutung: Gibt es eine Schwelle, ab der Vermögensansammlungen nicht mehr nur Wohlstand, sondern gesellschaftlichen Schaden verursachen? Wann wird Reichtum so extrem, dass er nicht nur ungerecht, sondern auch schädlich ist? Genau diese Thematik beleuchtet das Konzept der sogenannten extremen Wohlstandsschwelle, oder Extreme Wealth Line (EWL). Die extreme Wohlstandsschwelle unterscheidet sich grundlegend von der Armutsgrenze. Während letztere das untere Ende der gesellschaftlichen Einkommensverteilung markiert und sicherstellen soll, dass jeder Zugang zu grundlegenden Lebensnotwendigkeiten wie Nahrung, Unterkunft und Kleidung hat, beschäftigt sich die EWL mit dem oberen Ende der Skala.
Sie hinterfragt, ab welchem Punkt die Konzentration von Vermögenswerten – seien es Immobilien, Finanzanlagen oder produktive Landflächen – bei einigen wenigen Menschen derart hoch ist, dass daraus ungerechtfertigte und schädliche Auswirkungen auf Individuen, Gesellschaft und Umwelt entstehen. Im letzten Jahrzehnt haben sich die Verhältnisse dramatisch verschärft. Die reichsten ein Prozent der Weltbevölkerung hat über die Hälfte des neu generierten Weltvermögens für sich beansprucht. Die zehn reichsten Menschen besitzen mehr Vermögen als die ärmsten drei Milliarden zusammen. Noch alarmierender ist der ökologische Fußabdruck, denn der durchschnittliche CO2-Ausstoß eines Milliardärs ist eine Million Mal höher als der eines Durchschnittsbürgers.
Während die reichsten Menschen ihren Wohlstand derart massiv vermehren, stagniert die Armutsbekämpfung: Prognosen zufolge wird es mehr als zwei Jahrhunderte dauern, bis Armut auf globaler Ebene wirkungsvoll ausgerottet wird. Parallel dazu ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre der weltweit erste Billionär entsteht. Diese Zahlen schärfen den Blick auf eine bisher eher vernachlässigte Dimension der globalen wirtschaftlichen Ungleichheit – die Macht und die negativen Effekte von extremem Wohlstand. Die Einführung einer extremen Wohlstandsschwelle könnte einen Wendepunkt markieren, um diese Problematik sichtbar zu machen und gesellschaftliche sowie politische Debatten in konstruktive Bahnen zu lenken. In Interviews mit politischen Entscheidungsträgern, Fachleuten des Finanzwesens und Millionären aus Ländern wie Brasilien, Frankreich, Italien, Südafrika, Großbritannien und den USA zeigt sich eine breite Zustimmung zu der Idee, eine EWL zu definieren.
Dieses Instrument kann helfen, Diskurse über die Herkunft, Anhäufung und Verteilung von Reichtum anzustoßen und dessen potenzielle Schäden sichtbar zu machen. Die Kritik an extremer Vermögenskonzentration wird vielfach als Ausdruck eines systemischen Versagens interpretiert. Die extreme Konzentration von Kapital untergräbt den sozialen Zusammenhalt, schädigt das gesellschaftliche Vertrauensfundament und entfaltet eine zerstörerische Wirkung auf demokratische Prozesse. Der unterproportionale Einfluss einiger Weniger in Politik und Wirtschaft sowie die Vergrößerung ökologischer Schäden durch übermäßigen Ressourcenverbrauch sind oft direkte Folgen dieser Ungleichverteilung. Doch wie könnte eine solche extreme Wohlstandsschwelle konkret aussehen? In den Interviews waren die Meinungen breit gefächert.
Einige Millionäre plädierten für eine absolute Summe, die vom unteren Bereich von zehn Millionen Dollar bis zu einer Milliarde Dollar reicht, wobei viele eine Grenze um zehn Millionen als sinnvoll betrachteten. Politikexperten und Wissenschaftler neigten eher zu relativen Indikatoren, wie beispielsweise einem Verhältnis zwischen individuellem Vermögen und der Wirtschaftsleistung eines Landes oder der allgemeinen Einkommensverteilung. Ein wichtiger Punkt war dabei die Berücksichtigung von Faktoren wie Verfügbarkeit und Liquidität des Vermögens – also wie viel des Vermögens tatsächlich genutzt werden kann – sowie die Frage, ob dieser Besitz verhältnismäßig und gerecht verteilt ist. Der Vorschlag eines globalen Maßstabs für eine extreme Wohlstandsschwelle wird vor allem wegen seiner Klarheit und seiner Eignung zur internationalen Koordination als wertvoll erachtet. Globale Richtwerte könnten Unternehmen und Regierungen dabei helfen, Probleme wie Steuervermeidung oder Kapitalflucht gezielter zu adressieren.
Allerdings bevorzugt die Mehrheit der Befragten die Nutzung der EWL nicht als ein striktes Vermögenslimit, das das Ansammeln von Vermögen unmittelbar verbietet, sondern vielmehr als Grundlage für politische Maßnahmen, etwa progressive Steuerregime und andere Formen der Umverteilung. Darüber hinaus könnte das Konzept der EWL eine wichtige Rolle dabei spielen, die gegenwärtige Dominanz des Wachstumsparadigmas in der Weltwirtschaft in Frage zu stellen. Die Fokussierung auf unendliches Wachstum, ohne die sozialen und ökologischen Kosten ausreichend zu berücksichtigen, wird immer häufiger als problematisch erkannt. Die Diskussion über eine Wohlstandsschwelle trägt dazu bei, die Debatte darüber zu vertiefen, wie viel Wachstum und Reichtum besser zugunsten von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit gesteuert werden können. Die Einführung und Durchsetzung einer solchen Wohlstandsschwelle steht jedoch vor verschiedenen Herausforderungen.
Eine der größten Hürden ist der gesellschaftliche und politische Widerstand gegen die Regulierung von Vermögen, der oft mit Argumenten von individueller Freiheit und wirtschaftlicher Effizienz gerechtfertigt wird. Ebenso schwierig ist es, einen, von allen akzeptierten Wert festzulegen, der die vielfältigen ökonomischen Verhältnisse unterschiedlicher Länder berücksichtigt. Die Kontrolle von Reichtum, insbesondere bei grenzüberschreitender Vermögensverteilung und komplexen Rechtskonstruktionen, stellt einen weiteren Stolperstein dar. Um diese Hindernisse zu überwinden, werden weiterführende Forschungen benötigt, die die kausalen Zusammenhänge zwischen extremem Reichtum und gesellschaftlichen sowie ökologischen Folgen klarer herausarbeiten. Eine breite gesellschaftliche Einbindung, etwa durch deliberative Verfahren oder Bürgerforen, könnte helfen, Akzeptanz für diese komplexe Thematik zu schaffen und verschiedene Perspektiven zusammenzuführen.