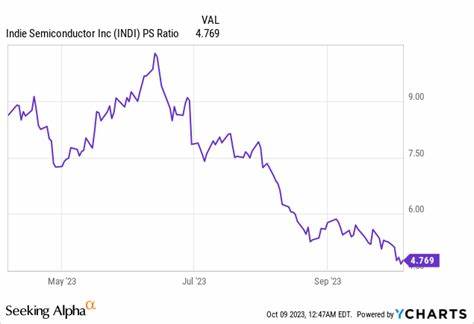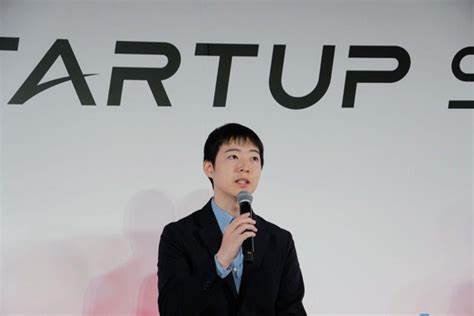Im Zeitalter der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz (KI) steht die Designbranche vor einem bedeutenden Wendepunkt. Die rasante Entwicklung generativer KI verändert nicht nur die Art und Weise, wie Designs erstellt werden, sondern wirft auch grundlegende Fragen über die Rolle und den Wert von Designerinnen und Designern auf. Gleichzeitig erleben wir eine bemerkenswerte Uniformierung der visuellen Kultur, die oft als „Zeitalter der Mittelmäßigkeit“ bezeichnet wird – eine Phase, in der Ästhetik zunehmend austauschbar und entleert wirkt. Um diesen Zustand zu verstehen, muss man die tieferliegenden Kräfte analysieren, die Mediokrität begünstigen, ebenso wie die Herausforderungen, die KI und die digitale Ökonomie an das Design stellen. Ebenso wichtig ist es, einen Blick auf die Zukunft des Designs und der Designer zu werfen, die sich neu definieren müssen, um in einer Welt, in der KI als Spiegel fungiert, weiterhin relevant zu bleiben.
Die visuelle Landschaft ist heute von einem beunruhigenden Einheitsbrei geprägt. Von minimalistischen Bars und Cafés bis hin zu generischen, serifenlosen Logos und monotonen Web-Interfaces dominiert eine Ästhetik, die Harmonie gegen Einzigartigkeit eintauscht. Dieser sogenannte „AirSpace“-Look – eine Mischung aus zurückhaltendem Design mit reclaimed wood und minimalistischen Möbeln – spiegelt eine tief verwurzelte Gleichschaltung wider. Es entsteht eine visuelle Monotonie, die nicht nur die Kreativität einschränkt, sondern auch die soziale und kulturelle Vielfalt verarmt. Diese visuelle Mediokrität ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels zwischen Marktmechanismen, sozialen Medien und der Sogwirkung der Aufmerksamkeitsökonomie.
Smartphones fungieren als der dominierende Kanal, durch den diese homogene Gestaltung in unser tägliches Leben gespült wird. Social-Media-Plattformen, die auf Wachstum durch Nutzerbindung ausgelegt sind, verstärken diese Tendenz zur Standardisierung nochmals erheblich. Algorithmen, die Nutzerverhalten analysieren und bewerten, fördern systematisch Designs und Inhalte, die maximale Interaktion garantieren. Dadurch entsteht ein sich selbst befeuernder Zyklus: Benutzer gewöhnen sich an wiederkehrende, vorhersehbare Muster und Entwickler passen ihre Designs entsprechend an, um die Systemanforderungen zu erfüllen. Die unendliche Scroll-Funktion etwa ist ein Paradebeispiel für eine Designentscheidung, die nicht dem Nutzerwohl dient, sondern der Verweildauer und der Monetarisierung.
Diese Rückkopplung von algorithmisch gesteuertem Nutzerverhalten und standardisierter Gestaltung trägt zur Entstehung eines scheinbar allgegenwärtigen, aber zugleich inhaltsleeren Designs bei. Aber nicht nur Social Media prägt das Bild. Transaktionale Plattformen wie Shopify, Salesforce Commerce Cloud oder Adobe Commerce setzen mit ihren Frameworks und Templates globale Standards für Nutzerinteraktionen. Obwohl sie Effizienz und Skalierbarkeit gewährleisten, fördern sie ebenfalls eine rigorose Normierung der Nutzererfahrung, bei der die Einzigartigkeit des Angebots zunehmend in den Hintergrund tritt. Das digitale Ökosystem wird so von einer industrialisierten Prozesskette dominiert, die wenig Raum für kreative Abweichungen lässt.
Auf diese Weise erfolgt eine umfassende Kodifizierung der digitalen Beziehungen zwischen Unternehmen und Nutzern, gemessen an Performance-Kennzahlen wie Conversion-Rates oder Customer Acquisition Costs. Die „Design-Systeme“, die hierbei zum Einsatz kommen, sind letztlich Tokeniserungsmechanismen im Sinne einer Fertigungsstraße für digitale Produkte. Im Zentrum dieses Phänomens steht die Aufmerksamkeit als kostbare Ressource, deren Kommodifizierung die Sichtbarkeit und Gestaltung definiert. Die Ästhetik unterliegt nicht mehr kulturellen Zyklen oder individuellen Geschmacksentscheidungen, sondern der unbarmherzigen Logik der Datenanalyse und Verhaltensökonomie. Die Folgen sind weitreichend: Marken, die einst durch unverwechselbare Identitäten brillierten, gleichen sich zunehmend an, um Risiken zu minimieren.
Kunden fordern vor allem das Bekannte, das Sichtbare, das Erwartbare; die Akzeptanz für Experimente und Innovationen schwindet. In diesem Vergleich sind Designer oft zu Spiegeln ihrer eigenen Branche geworden – sie reproduzieren statt zu provozieren, imitieren statt zu erschaffen. Dieses Phänomen lässt sich auch als eine Kognition des kognitiven Outsourcings verstehen. Anstatt Fragen kritisch zu hinterfragen, greifen Designer und Auftraggeber auf bereits validierte Lösungen zurück, die als sicher und erprobt gelten. Es entsteht eine Art kollektives Nachahmungsverhalten, das sich in der „Dead-Internet-Theorie“ widerspiegelt: Digitale Inhalte gleichen immer mehr automatisierten Prozessen oder zu stark angepassten menschlichen Verhaltensmustern, bis sie kaum noch unterscheidbar sind.
Die Folge ist eine Erschöpfung und Frustration der Nutzer, die sich in immer wiederkehrenden Mustern verlieren und am Ende die gesamte digitale Erlebniswelt als belang- und bedeutungslos empfinden. Gleichzeitig tritt die Künstliche Intelligenz als Katalysator und Spiegelbild dieser Entwicklungen in den Vordergrund. KI ist kein primärer Verursacher des Verlusts an Originalität, sondern reflektiert und verstärkt bestehende Dynamiken. Die Automatisierung verknüpft mit AI-Technologien macht die Replikation von standardisierten Mustern einfacher und schneller. Andererseits öffnet der leichtere Zugang zu Design- und Produktionsmitteln durch KI auch die Tore für ein demokratisiertes „Designen“: Menschen ohne klassisches Designwissen können mit ein paar einfachen Sprachbefehlen komplexe Bild- oder Interface-Konzeptionen erstellen.
Dadurch verschieben sich die Machtverhältnisse in der Herstellung von visuellen Produkten grundlegend. Enzo Mari, einer der bedeutenden Vorreiter des bewussten und ethisch fundierten Designs, warnt seit Jahrzehnten vor der Reduktion von Design auf reine Marktbedürfnisse und ästhetisches Beiwerk. Sein Projekt „Autoprogettazione“ mahnt zur Demokratisierung von Gestaltung, indem er offene Baupläne für Möbel publizierte, die jeder selbst herstellen kann. Für Mari ist Design ein sozialer Akt, der Wissen und Verantwortung verbindet und sich der Schnelllebigkeit und Oberflächlichkeit widersetzt. Er forderte Designerinnen und Designer auf, über Ästhetik hinauszugehen, ihr Tun politisch zu verorten und für eine gesellschaftliche Verbesserung einzutreten.
Bruno Munari wiederum unterstrich Design als eine disziplinierte, methodisch fundierte Praxis, die im Wechselspiel von Funktion, Material, Technik und Nutzerpsychologie eine exakte, sinnvolle Form sucht. Sein Konzept der „forma esatta“ steht für gestalterische Klarheit und ein kreatives Spiel zwischen Fantasie und Rationalität, das für die Qualität von Design elementar ist. Design ist für Munari eine respektierte Wissenschaft; Spieltrieb und Forschermut sind dabei Werkzeuge, um praktische und gesellschaftliche Problemstellungen elegant zu lösen. Diese beiden Positionen – Mari und Munari – bilden den intellektuellen Kompass für eine aktuelle Neubetrachtung dessen, was Design und Designer sein können und sollen. Eine prägnante Definition umfasst drei Kernqualitäten: intellektuelle Neugier, ethischer Zweck und spielerisches Experimentieren.
Designer im Sinne dieser Definition sind nicht Personen, die nur Methoden und Werkzeuge beherrschen, sondern denken über den Tellerrand hinaus, hinterfragen bestehende Systeme sozialer und technischer Art und kreieren mit Verantwortung und Kreativität. Die Realität zeigt jedoch ein anderes Bild. Das Design ist immer stärker industrialisiert und zersplittert in spezialisierte Einzelfächer wie UI-, UX-, Produkt- oder Service-Design. Diese Hyper-Spezialisierung führt häufig zu Tunnelblick und einer reduzierten Sicht auf Gestaltungsaufgaben, die der Rolle des Designers nur als ausführendes Rädchen im Gesamtgefüge entspricht. Strategische Relevanz und Einfluss im unternehmerischen Kontext nehmen ab, während operative Aufgaben und kurzfristige Optimierungen dominieren.
Die dadurch entstehende Entfremdung zwischen Design und Nutzerbedürfnissen schwächt die Qualität und Identität von Designprodukten. Besonders auffällig ist die Marginalisierung von Design auf den untersten Ebenen der Produktentwicklung, während die strategischen Entscheidungen meist in Führungsebenen ohne direkte Design-Vertretung getroffen werden. Die Rolle eines Chief Design Officer (CDO) ist im Vergleich zu anderen Führungspositionen wie CMO, CTO oder CXO in Unternehmen nach wie vor selten etabliert. Dadurch bleiben viele wichtige Fragen des Designs unbeantwortet, oder sie werden von anderen Abteilungen dominiert, die andere Prioritäten verfolgen. Ein weiterer problematischer Aspekt ist der zunehmende Griff von Beratungsunternehmen in die Design-Welt.
Große Strategieberatungen integrieren Design-Konzerne, was zwar einerseits das Ansehen von Design erhöht, andererseits aber durch die Orientierung an Abrechnungsmodellen und Organisationsgrößen zu einer Verwässerung der inhaltlichen Tiefe führen kann. Design wird dadurch zum skalierbaren Service, verliert aber den Dialog mit Nutzer- und Gesellschaftsrealität, der für seine Wirksamkeit essenziell ist. Design Thinking, weithin als Innovationsmotor gepriesen, erfährt durch seine institutionalisierte Anwendung eine gewisse Abnutzung. Ursprünglich als interdisziplinäre Methode zur Lösung komplexer Probleme konzipiert, hat sich Design Thinking in manchen Organisationen zum ritualisierten Werkzeug reduziert, das vor allem Prozesse und Meetings organisiert, statt echte Kreativität und strategische Einsicht zu fördern. Der eigentliche Nutzen gerät so oft zugunsten formaler Abläufe und Marktfokussierung in den Hintergrund.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass das professionelle Design heute vielfältigen Zwängen unterworfen ist. Die Gefahr, von der KI als nächster Optimierungsschritt ersetzt zu werden, ist real. KI übernimmt nämlich immer leichter routinemäßige Aufgaben, die sich auf datengetriebene Optimierung stützen. Diejenige Designarbeit, die sich über bloße Produktion hinaus durch eigenständiges Denken, kritische Reflexion und ethische Orientierung auszeichnet, bleibt herausfordernd und damit in der Verantwortung menschlicher Designerinnen und Designer. Die Rückkehr des Designers als gestaltendem Akteur ist aber keine utopische Wunschvorstellung.
KI kann auch als befreiende Kraft wirken, vergleichbar mit Mari’s Autoprogettazione. Sie ermöglicht es, produzierende Kräfte zu demokratisieren und mehr Menschen die Teilhabe am schöpferischen Prozess zu ermächtigen. Damit wächst der Anspruch an Designerinnen und Designer, sich als ethische Agenten, intellektuelle Forscher und kritische Technologen zu positionieren. Sie müssen Technologie nicht nur bedienen, sondern verstehen, hinterfragen und zum Werkzeug für positive Veränderung formen. In der Zukunft wird der Designwettbewerb weniger über schnell produzierte Designs und mehr über die Fähigkeit geführt werden, Haltung, Substanz und Glaubwürdigkeit zu vermitteln.
Designerinnen und Designer werden als Kuratorinnen und Kuratoren gefragt sein, die gesellschaftliche Werte vertreten und mit fundiertem Wissen spielen und experimentieren, um tatsächlich „exakte Lösungen“ zu finden – jenseits von kurzfristigem Trend und Oberflächlichkeit. Das Zeitalter der Mittelmäßigkeit kann so durch die bewusste, ethisch orientierte Gestaltung überwunden werden. Dafür braucht es eine Renaissance des Designerberufs, die jenseits von Jobtiteln und Methodengläubigkeit den Menschen in den Mittelpunkt stellt und sich der komplexen Realität der digitalen und sozialen Welt stellt. KI ist dabei kein Ersatz, sondern ein Spiegel, der uns zeigt, wie weit wir uns von den Idealen eines reflektierten, gesellschaftlich relevanten Designs entfernt haben – und wie groß zugleich die Chancen sind, uns neu zu erfinden und bessere, nachhaltigere Welten zu schaffen.