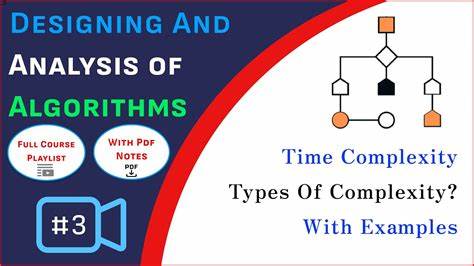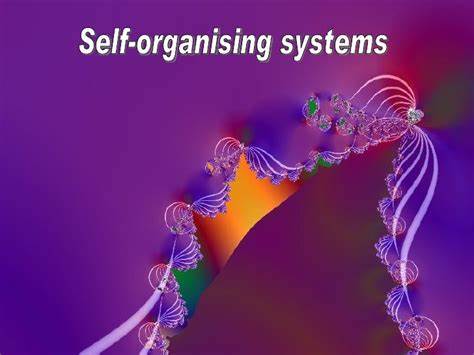Das 21. Jahrhundert wird oft als das Jahrhundert der Komplexität bezeichnet – eine Ära, in der das Verständnis komplexer Systeme essenziell für den Fortschritt von Wissenschaft und Gesellschaft ist. Komplexität entsteht durch das Zusammenwirken vieler einzelner Komponenten oder Untereinheiten, die auf unterschiedlichste Weise interagieren und so emergente Phänomene erzeugen, die auf verschiedenen Ebenen sichtbar werden. Dieses Zusammenspiel geht weit über das hinaus, was sich aus den Eigenschaften der Einzelteile ableiten lässt und öffnet ein faszinierendes Forschungsfeld, das sich durch seine Vielschichtigkeit und Interdisziplinarität auszeichnet. Dabei führen gerade die oft überraschenden globalen Auswirkungen lokaler Wechselwirkungen Wissenschaftler dazu, traditionelle Denkweisen zu hinterfragen und neue methodische Zugänge zu entwickeln.
Die bedeutende Herausforderung liegt nicht nur in der Untersuchung komplexer Systeme an sich, sondern auch darin, wie Fachdisziplinen sich miteinander vernetzen, um diese Erkenntnisse zu fördern und anzuwenden. Die Wurzeln der Komplexitätswissenschaft sind vielfältig und reichen weit zurück. Bereits in der Philosophie der Antike sowie in östlichen Denktraditionen existierten Überlegungen, die dem Gedanken komplexer Systeme nahekommen. Besonders spannend ist die historische Entwicklung im Westen, die unter anderem auf René Descartes zurückgeht. In seinem Werk „Die Leidenschaften der Seele“ von 1649 beschreibt er menschliches Leben als Netzwerk unterschiedlichster, zusammenwirkender Teile, die lokal beeinflussen und dennoch globale Konsequenzen haben können.
Diese frühe Vorstellung zeigt die Einsicht, dass einfache Ursache-Wirkung-Ketten oftmals nicht ausreichen, um das Verhalten komplexer Systeme zu erklären. Formaler wurden diese Ideen erst im 20. Jahrhundert ausgearbeitet. Herbert Simon lieferte 1962 mit seinem Aufsatz „The Architecture of Complexity“ wesentliche Grundlagen für die wissenschaftliche Betrachtung. Er betonte, dass Komplexität nicht einfach durch die Summe von Einzelteilen erklärbar ist, sondern durch die hierarchisch organisierte Struktur von Systemen erschlossen werden muss.
Ein Jahrzehnt später widmete sich der Physiker Philip W. Anderson in seiner Arbeit „More Is Different“ dem Prinzip, dass das Reduzieren komplexer Systeme auf Grundelemente nicht zwangsläufig zu einem besseren Verständnis auf höheren Ebenen führt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, unterschiedliche Perspektiven zu integrieren, anstatt auf eine rein reduktionistische Herangehensweise zu setzen. Unterstützt wurde diese Sichtweise auch von Philosophen wie Edgar Morin, der in den 1970er- und 1990er-Jahren mit seiner „Philosophie der Komplexität“ die Grenzen der herkömmlichen Systemtheorie aufzeigte und komplexe Denkweisen propagierte, die soziale, historische und gefühlsmäßige Kontexte miteinbeziehen. In den Naturwissenschaften spiegelte sich diese Entwicklung vor allem im Studium lebender Systeme wider.
Der Physiker Erwin Schrödinger stellte die These auf, dass das vollständige Verständnis von Leben neue physikalische Gesetze benötigen könnte, da biologische Prozesse sich in ihrer Komplexität fundamental von den klassischen physikalischen Phänomenen unterschieden. Parallel dazu entstanden durch die Arbeiten von John von Neumann und Stanisław Ulam theoretische Konzepte selbstreplizierender Maschinen, die die Entstehung biologischer Komplexität simulieren sollten und wichtige Grundlagen für die moderne Informatik legten. In den 1980er- und 1990er-Jahren entwickelten Wissenschaftler wie Stuart Kauffman und Per Bak Theorien zur Selbstorganisation und kritischen Zuständen in komplexen Systemen, die zeigen, wie Strukturen spontan aus einfachen Interaktionen entstehen können. Die Erforschung von Netzwerken bildete in der Folgezeit einen zentralen Schwerpunkt. Netzwerke sozialer, biologischer oder technischer Natur lassen sich mit Mitteln der Physik, Mathematik und Sozialwissenschaft analysieren, um ihre Funktionsweise und Dynamik verständlich zu machen.
Auch aktuelle Herausforderungen wie die Verbreitung von Epidemien oder Fehlinformationen nutzen inzwischen Modelle, die biologische und soziale Contagion-Phänomene vereinen. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass Komplexitätswissenschaften als eine Gemeinschaft von Forschern verschiedener Disziplinen zusammenarbeiten, um gemeinsame Fragestellungen zu bearbeiten. Die Komplexitätsforschung lässt sich dabei eher als eine methodische Haltung und Gemeinschaft betrachten, denn als einzelne Disziplin mit festen Werkzeugen. Sie lebt von der Offenheit, sich interdisziplinär zu vernetzen und neue Perspektiven zu integrieren. Ursprünglich von Philosophen, Ökonomen und Physikern geprägt, sind mittlerweile Computerwissenschaftler, Statistiker, Biologen, Anthropologen und Politikwissenschaftler Teil dieser wachsenden Gemeinschaft.
Diese Vielfalt ist notwendig, da komplexe Systeme in unterschiedlichsten Kontexten auftreten – von Nahrungsnetzwerken in der Ökologie über neuronale Verschaltungen bis hin zu Governance-Strukturen in Gesellschaften. Ein wichtiger gemeinsamer Nenner ist die Erkenntnis „more is different“ – das heißt, das Verhalten eines Systems lässt sich nicht allein durch die Betrachtung einzelner Teile erklären. Die Herausforderung, idealisierte Einzellösungen durch ganzheitliche Sichtweisen zu ersetzen, führte zur Etablierung zahlreicher neuer Forschungsfelder und zur Entwicklung gemeinsamer Modelle und Theorien. Die Komplexitätsforschung strebt nach einer Synthese von Methoden und Erkenntnissen, die schwierigste Probleme in Wirtschaft, Gesellschaft und Natur besser begreifbar machen. Trotz dieser positiven Entwicklungen stehen Forscher vor der Herausforderung, dass traditionelle wissenschaftliche Publikationssysteme häufig disziplinär strukturiert sind und somit interdisziplinäre Arbeiten erschwert zugänglich gemacht werden.
Viele Arbeiten zur Komplexität müssen sich entweder an jeweilige Fachjournalisten anpassen, was die integrative Perspektive verwässern kann, oder versuchen, multidisziplinär breit aufgestellte Magazine zu nutzen, die jedoch häufig keine gezielte Plattform für Komplexitätsforschung bieten. Das neu gegründete Journal npj Complexity zielt genau darauf ab, diesen Raum zu schaffen, der explizit komplexe Forschung an den Schnittstellen verschiedener Disziplinen fördert und einem breiten Publikum zugänglich macht. Essenziell ist hierbei, dass eingereichte Arbeiten verständlich für Leser unterschiedlicher Fachrichtungen sind und sich so im Geiste der Offenheit der Komplexitätsgemeinschaft entfalten können. Dabei darf Komplexitätsforschung nicht beliebig werden. Ihre wissenschaftliche Integrität hängt davon ab, dass durch Vielfalt von Expertenwissen ein kritisches Bewusstsein für Methoden, Begriffe und Annahmen bestehen bleibt.
Andernfalls droht die Komplexitätswissenschaft, zu einer eigenständigen Disziplin mit Fachjargon und Grenzen zu werden, der es an Offenheit mangelt. Der Anspruch von npj Complexity ist deshalb, Wissenschaftler daran zu erinnern, neugierig und interdisziplinär zu bleiben – eine Haltung, die der Physiker und Komplexitätswissenschaftler Murray Gell-Mann bereits treffend formulierte. Er beschrieb die wissenschaftliche Erforschung komplexer Systeme als ein spielerisches Ringen mit Neugierde. Komplexität ist kein isoliertes Forschungsfeld, sondern steht in Verbindung mit verwandten Konzepten wie Systemtheorie, Kybernetik, Ökologie oder Politikwissenschaft. Die Verwendung des Begriffs Komplexität signalisiert zugleich die Offenheit dieses Feldes, denn die Vieldeutigkeit des Begriffes ermöglicht neue Zugänge und Ideen.
Für Wissenschaftler bedeutet dies jedoch auch, dass eine klare Fokussierung auf ganzheitliche Perspektiven erforderlich ist, um die daraus resultierenden Erkenntnisse gut in bestehende Wissenschaftslandschaften einzubetten. Das Spektrum der Komplexitätsforschung reicht heute von Netzwerkwissenschaft über künstliches Leben, computational social science, Systembiologie, Datenwissenschaft bis hin zu Ökologie, Dynamischen Systemen, Volkswirtschaftslehre und sozialer Komplexität. Die großen Herausforderungen unserer Zeit, sei es die Pandemie-Bekämpfung, der Umgang mit Fehlinformationen, Klimawandel, soziale Ungleichheiten oder die Anpassung an neue Technologien, zeigen, wie eng verwoben viele komplexe Systeme sind. Sie alle erfordern Denkmodelle und Lösungsansätze, die verschiedene Disziplinen miteinander verbinden und deren Wechselwirkungen berücksichtigen. Nur durch diese grundlegend vernetzte Sichtweise können nachhaltige und wirksame Antworten auf globale Probleme gefunden werden.
Die Zukunft der Komplexitätswissenschaft wird maßgeblich von der Fähigkeit abhängen, weiterhin Brücken zwischen den Disziplinen zu bauen und gemeinschaftlich neue Verständnisebenen zu erschließen. Forschung muss sich dabei nicht vor der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes fürchten, sondern diese als Chance begreifen, neue Fragen zu stellen und interaktive Lösungen zu entwickeln. Die Kommunikationswege innerhalb der Gemeinschaft spielen hierbei eine zentrale Rolle, genauso wie die Offenheit gegenüber ungewöhnlichen und kreativen Ideen. Diese einzigartige Mischung aus Neugier, methodischer Offenheit und interdisziplinärem Dialog macht den Weg der Komplexität zu einem dynamischen und zukunftsweisenden Prozess. Die Komplexitätswissenschaft fordert Forscher heraus, traditionelle Disziplingrenzen zu überschreiten und damit das Wissen durch Zusammenarbeit auf ein neues Niveau zu heben.
Indem sie die Verbundenheit aller Teile eines Systems in den Mittelpunkt stellt, eröffnet sie Perspektiven auf ganzheitliche Lösungen für die drängendsten Fragen unserer Zeit. So steht der Weg der Komplexität zugleich für eine wissenschaftliche Haltung, die Neugier und Kreativität mit methodischer Strenge verbindet. Sie ist ein Aufruf an die Forschungsgemeinschaft, in einer zunehmend vernetzten Welt gemeinsam Antworten zu finden, die den komplexen Herausforderungen gerecht werden. Dabei geht es nicht nur um Wissenschaft, sondern um das Verstehen der Welt als ein zusammenhängendes Ganzes, das erst durch die Vielfalt seiner Teile in seiner Tiefe begreifbar wird.