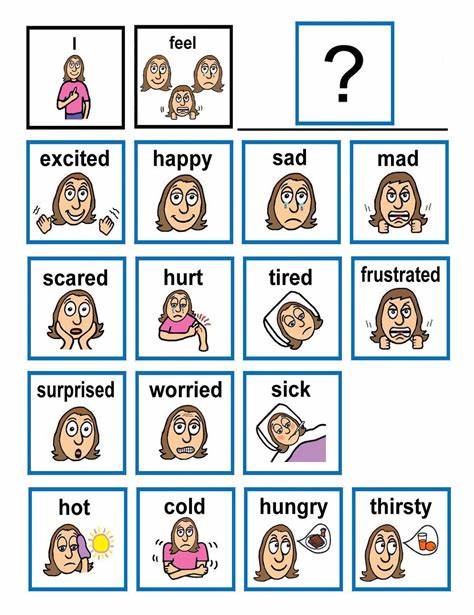Am 29. April 2025 ereignete sich ein massiver Stromausfall, der weite Teile Spaniens, Portugals und sogar Teile Südwestfrankreichs betraf. Millionen Menschen waren von den plötzlichen und umfassenden Stromunterbrechungen betroffen. Die betroffenen Regionen umfassten große Metropolen wie Madrid, Barcelona und Lissabon, was zu weitreichenden Störungen im öffentlichen und privaten Leben führte. Neben dem Ausfall der Haushaltsstromversorgung waren auch öffentliche Verkehrsmittel, Ampelanlagen und sogar renommierte Veranstaltungen wie das Madrid Open Tennisturnier betroffen, was sofort zum Chaos beitrug.
Die spanischen und portugiesischen Regierungen, verbunden mit den zuständigen Netzbetreibern, reagierten umgehend, um die Ursache zu finden und den Strom möglichst schnell wiederherzustellen. Das Ereignis war so erheblich, dass es viele Fragen aufwarf, darunter auch, ob ein Cyberangriff für den Ausfall verantwortlich sein könnte. Laut Red Eléctrica de España (REE), dem spanischen Netzbetreiber, wurde dieser Blackout als „el cero“ – zu Deutsch „die Null“ – bezeichnet. Das Gegenstück in Portugal, Redes Energéticas Nacionais (REN), verortete den Ausfall auf 11:33 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Schon am Nachmittag des gleichen Tages begann REE in mehreren Teilen der Iberischen Halbinsel mit der vorsichtigen Spannungswiederherstellung.
Dies musste schrittweise erfolgen, um weitere Belastungen des Netzes zu vermeiden, besonders beim Wiederanschluss der einzelnen Generatoren. Die größten Energieversorger Spaniens, Endesa und Iberdrola, arbeiteten eng mit REE zusammen, um in Übereinstimmung mit Standardprotokollen die Versorgung wieder zu normalisieren. Die genaue Ursache des Stromausfalls ist noch nicht abschließend geklärt. Der portugiesische Premierminister Luís Montenegro verkündete, dass das Problem seinen Ursprung in Spanien gehabt habe. REE selbst äußerte sich zunächst nicht detailliert zu den Ursachen.
Erste Berichte, die teilweise sogar fälschlich REN zugeschrieben wurden, sprachen von einem „seltenen atmosphärischen Phänomen“. Dieses Statement wurde später aber zurückgenommen. Allerdings sind die Auswirkungen atmosphärischer Temperaturveränderungen auf elektrische Leitungen in der Energiebranche bekannt. Veränderungen der Außentemperatur können die sogenannten Leiterparameter verändern, sprich die Fähigkeit der Leitungen, Elektronen zu transportieren. Vibrationen führen dazu, dass sich die Amplitude der Leiter – also ihre Leistungsfähigkeit – merklich verringert.
Daraus entsteht das Problem, dass das Angebot und die Nachfrage an elektrischer Energie nicht richtig ausgeglichen werden können. Diese Ungleichgewichte können sich innerhalb des Netzes schnell auswirken und zu komplexen Kaskadeneffekten führen. Der Energieexperte Taco Engelaar erklärte, dass Schwankungen der Temperatur diesen Effekt erklären könnten. Diese Entwicklungen führten zu einem „Kaskadenausfall“ von Kraftwerken, auch eines in Frankreich. Georg Zachmann, ein renommierter Senior Fellow am Brüsseler Thinktank Bruegel, schilderte, dass das Stromnetz auf eine Frequenzuntergrenze von 50 Hertz ausgelegt ist.
Sobald die Frequenz unter dieses Niveau fällt, schalten sich Kraftwerke automatisch ab, um Schäden zu vermeiden. Dies ist ein wichtiger Schutzmechanismus, der jedoch große Teile des Netzes lahmlegen kann, wenn er in kurzer Zeit mehrfach ausgelöst wird. Die Frage, ob ein Cyberangriff eine Rolle spielte, war innerhalb der Öffentlichkeit und der Spezialisten schnell präsent. António Costa, der Präsident des Europäischen Rates und ehemalige portugiesische Ministerpräsident, betonte ausdrücklich, dass es keine Beweise für eine Cyberattacke gebe. Auch Teresa Ribera, eine hochrangige Vertreterin der Europäischen Kommission, bestätigte gegenüber Radio 5 in Spanien, dass es keinen Hinweis auf eine vorsätzliche, böswillige Aktion im Zusammenhang mit dem Ausfall gebe.
Gleichzeitig wurde jedoch eine Sicherheitsbewertung auf höchster Ebene in Spanien initiiert, und portugiesische Behörden hielten weitere Untersuchungen für notwendig, um alle Möglichkeiten auszuschließen. Die Iberische Halbinsel ist bekannt für ihre fortschrittlichen Bemühungen im Bereich erneuerbarer Energien. Spanien hat in den letzten Jahren seine Nutzung von Solar- und Windenergie massiv ausgebaut und setzte im Vorjahr mit 56 Prozent Stromanteil aus erneuerbaren Quellen einen Rekord. Langfristig ist geplant, diesen Anteil bis 2030 auf 81 Prozent zu erhöhen. Diese ambitionierten Ziele spiegeln das Bestreben wider, die Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren und das Land ökologisch nachhaltiger aufzustellen.
Allerdings bringt der rapide Ausbau erneuerbarer Energien auch neue Herausforderungen mit sich. Wind- und Solarkraftwerke erzeugen nicht konstant Strom, sondern sind wetterabhängig und schwankend, was die Planung und den Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage verkompliziert. Das Stromnetz muss immer in Balance gehalten werden, um Überlastungen oder Unterversorgung zu vermeiden. Die Netzstabilität war schon immer eine kritische Komponente der Energieinfrastruktur. Traditionell wurde die Frequenz des Stromnetzes über sogenannte „rotierende Reserve“ durch Gaskraftwerke ausgeglichen.
Diese Turbinen können flexibel hoch- oder runtergefahren werden, um Schwankungen auszugleichen. Mit dem Übergang zu erneuerbaren Energien, die oft auf nicht-rotierenden Technologien basieren, müssen Netzbetreiber jedoch in neue Technologien wie Schwungräder, fortschrittliche Leistungselektronik und andere Regelungsmechanismen investieren, um das System stabil zu halten. Georg Zachmann warnt in diesem Kontext, dass die Investitionen in solche Stabilitätsmechanismen unverzichtbar sind, da die Komplexität der Netze weiter wächst. Ein weiterer kritischer Faktor ist die Rolle internationaler Stromverbindungen. Die Iberische Halbinsel ist über Hochspannungsleitungen mit Frankreich und weiteren europäischen Ländern verbunden.
Solche Interkonnektoren ermöglichen den Austausch von Strom, Ausgleich von Lastspitzen und tragen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit bei. Gleichzeitig können sie aber auch die Ausbreitung von Störungen beschleunigen. Historisch betrachtet kam es bereits in der Vergangenheit zu großflächigen Ausfällen, die durch Probleme in internationalen Verbindungen ausgelöst wurden – etwa der große Stromausfall in Italien 2003 durch einen Fehler an der Wasserleitung zwischen italienischen und schweizerischen Netzsystemen, der mehr als 50 Millionen Menschen betraf. 2006 führte ein Überlastungsproblem in Deutschland zu Störungen, die bis nach Portugal und Marokko reichten. Experten wie Taco Engelaar betonen jedoch, dass trotz der Risiken die Vorteile der Vernetzung überwiegen.
Internationale Verbindungen wirken auch als Puffer und helfen dabei, das Stromnetz in kritischen Situationen zu stabilisieren. Georg Zachmann ergänzt, dass gerade die Verbindung mit Frankreich nach dem aktuellen Vorfall entscheidend sein werde, um eine schnelle Wiederherstellung der Netzstabilität zu ermöglichen. Zusammenfassend zeigt die Analyse des Stromausfalls, dass die Ursachen vielschichtig sind und vor allem mit komplexen physikalischen und technischen Faktoren zusammenhängen, die durch außergewöhnliche Umstände ausgelöst wurden. Die aktuelle Lage verdeutlicht, dass das Stromnetz der Iberischen Halbinsel sich in einer sensiblen Übergangsphase befindet – geprägt vom wachsenden Anteil erneuerbarer Energiequellen und den daraus resultierenden Anforderungen an Netzmanagement, Technologie und Infrastruktur. Die Debatte um die Möglichkeit eines Cyberangriffs hat sich bislang als unbegründet herausgestellt.