Die Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformation im Internet stellt eine der größten Herausforderungen für Gesellschaften weltweit dar. Auch Großbritannien reagierte auf diese Problematik mit der Verabschiedung des Online Safety Act, der am 17. März 2025 in Kraft trat. Doch was bedeutet dieses Gesetz eigentlich konkret für den Umgang mit falschen Informationen im Netz? Deckt der Online Safety Act tatsächlich Desinformation ab, oder gibt es Einschränkungen, die seine Wirksamkeit begrenzen? Eine genaue Betrachtung zeigt, dass die Situation komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Zunächst ist es wichtig, den Kontext zu verstehen, in dem der Online Safety Act entstanden ist.
Großbritannien wurde im Sommer 2024 von schweren Unruhen erschüttert, die aus der Verbreitung falscher sozialer Medienposts hervorgingen. Falsche Behauptungen über einen Täter an einem Kindergeburtstag führten zu gewaltsamen Ausschreitungen, wobei Hass und Vorurteile eine zentrale Rolle spielten. Diese Ereignisse waren ein Weckruf für die Gesetzgeber, die Grenzen der bisherigen Regulierung zu überwinden und neue Wege zu finden, um Online-Schäden effektiver zu bekämpfen. Baroness Jones of Whitchurch, zuständige Ministerin für Wissenschaft, Innovation und Technologie, betonte im April 2025 vor dem Parlament, dass das Gesetz sowohl Fehlinformation als auch Desinformation umfasse. Allerdings beziehe sich dies primär auf illegale Inhalte, insbesondere wenn diese Kinder betreffen oder schädlichen Einfluss auf Minderjährige haben.
Das Online Safety Act zielt also vorrangig darauf ab, gefährliche und illegale Inhalte, die Kinder gefährden können, zu regulieren. In solchen Fällen sind Plattformbetreiber verpflichtet, entsprechende Inhalte zu entfernen oder präventive Maßnahmen zu ergreifen. Auf der anderen Seite gibt es erhebliche Diskussionen darüber, inwieweit das Gesetz auch falsche Informationen betrifft, die sich an Erwachsene richten oder nicht klar als illegal eingestuft werden können. Kommunikationsexperten und Politiker wie die Ausschussvorsitzende Chi Onwurah weisen darauf hin, dass das Kommunikationsaufsichtsorgan Ofcom keine ausdrückliche Pflicht habe, gegen Fehlinformationen vorzugehen, solange diese nicht illegal sind. Dies stellt eine Schwachstelle im Gesetz dar, da viele Arten von Desinformation zwar schädlich sind, aber keine klaren rechtlichen Verbote verletzen.
Ofcom selbst bestätigte, dass die vorherige Regierung entschieden hatte, schädliche Inhalte für Erwachsene aus dem Geltungsbereich herauszunehmen. Dazu zählen auch viele Formen von Desinformation. Dennoch arbeitet Regulierungsbehörde aktuell an einem Informationsbeirat, um die Rolle von Fehlinformation besser einzuschätzen und Empfehlungen für den Umgang zu entwickeln. Dabei wurde auch ein neuer Straftatbestand eingeführt: das Verbreiten falscher Informationen mit der Absicht, Schaden zu verursachen. Dieser Punkt ist jedoch schwer durchzusetzen, da die Absicht nachzuweisen oft eine erhebliche Hürde darstellt.
Der Gesetzgeber und Experten sehen daher eine Art Grauzone: Das Gesetz erfasst Inhalte, die klar illegal sind – etwa die Anstiftung zu Gewalt, Hassrede oder Kindergefährdung – und sieht Strafen bei vorsätzlicher Verbreitung falscher Behauptungen vor. Doch viele alltägliche Formen von Fehlinformation, die ebenfalls gesellschaftliche Schäden verursachen können, wie beispielsweise falsche Gesundheitsinformationen oder politische Manipulation, sind oft nicht ausreichend abgedeckt. Hier vertrauen die Regulierer auf die Selbstverantwortung der Plattformen und ihre Verpflichtung, ihre eigenen Nutzungsbedingungen durchzusetzen. Ein kritischer Punkt dabei ist, dass viele große soziale Medienunternehmen in Anhörungen angaben, dass das Inkrafttreten des Online Safety Act ihre Reaktion auf die Unruhen im Sommer 2024 kaum beeinflusst hätte. Sie sehen die Anforderungen des Gesetzes als teilweise zu vage oder als Herausforderung, die in der Praxis schwer umsetzbar ist.
Das wirft Zweifel daran auf, wie effektiv der Online Safety Act künftig die Verbreitung von Desinformation eindämmen kann, insbesondere wenn schnelles Handeln in Krisensituationen gefordert ist. Die Ministerin Baroness Jones ist dennoch überzeugt, dass das Gesetz eine Verbesserung gegenüber vorherigen Regelungen darstellt. Wenn sich ähnliche Ereignisse wie die Southport-Unruhen wiederholen sollten, könnten die bestehenden vorgeschriebenen Maßnahmen und der Straftatbestand der absichtlichen falschen Kommunikation eine stärkere rechtliche Handhabe bieten. Dies ist ein entscheidender Unterschied zu früheren Zeiten, in denen Plattformen oftmals ohne klare Verpflichtungen agierten. Die breitere Herausforderung bleibt jedoch, wie man wirksame Regeln gestaltet, die einerseits die Meinungsfreiheit respektieren und andererseits den Schutz vor schädlicher Fehlinformation gewährleisten.
Auch wenn das Gesetz auf dem Papier zum Schutz von Kindern und gegen illegale Inhalte umfangreiche Pflichten vorsieht, zeigt die Praxis, dass die Abgrenzung zwischen erlaubter und nicht erlaubter Information schwierig ist. Insbesondere die technischen und juristischen Anforderungen zur Auswertung der Absicht hinter einer falschen Aussage können leicht zum Hindernis werden. Eine positive Entwicklung ist die Einrichtung des Informationsbeirats bei Ofcom, der die nötigen fachlichen Grundlagen und Empfehlungen erarbeiten soll, wie mit nicht ganz illegaler, aber dennoch schädlicher Fehlinformation umzugehen ist. Experten hoffen, dass mit fortschreitender Rechtsprechung und Praxis weitere Klarheit geschaffen wird, so dass das Gesetz effektiv greifen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der UK Online Safety Act zwar bestimmte Formen von Desinformation abdeckt, vor allem bei illegalen und kindergefährdenden Inhalten.



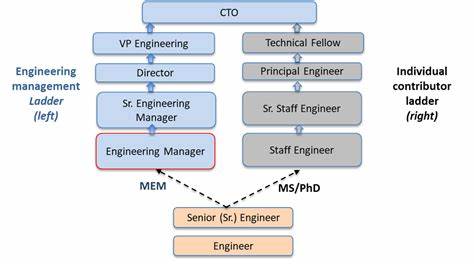
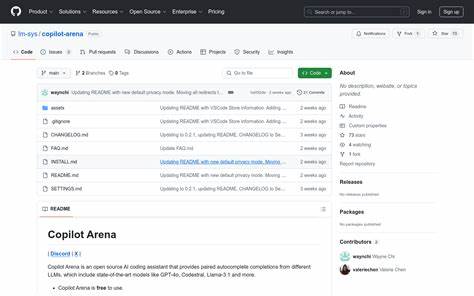

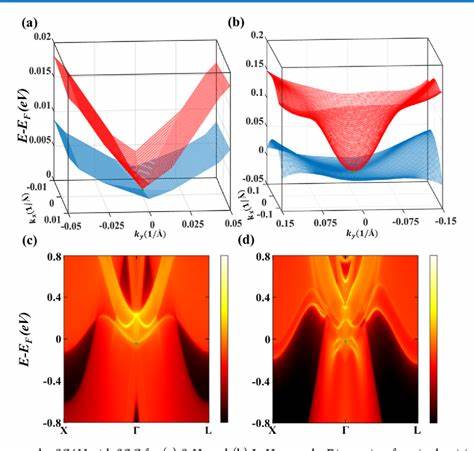

![The Only Auto Show That Matters: 2025 Shanghai Auto Show [video]](/images/DFF491EB-0001-4CEB-8BF5-096763B97023)
