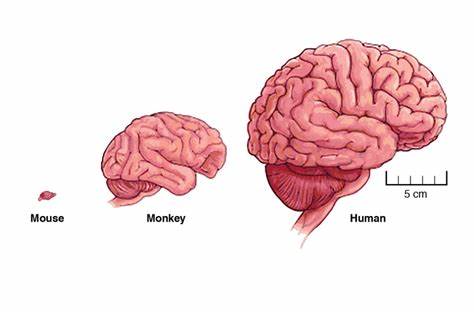Island hat in den letzten Jahren mit der Einführung einer verkürzten Arbeitswoche große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Seit 2019 arbeiten etwa 90 Prozent der isländischen Beschäftigten mit einer verkürzten Arbeitszeit von 36 Stunden statt der traditionellen 40 Stunden pro Woche. Dieses Konzept ist kein bloßer Versuch, weniger zu arbeiten, sondern ein durchdachtes Modell, das dazu beiträgt, Stress zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und das Familienleben zu verbessern. Die Umsetzung dieser Arbeitszeitverkürzung galt lange Zeit als riskant und politisch schwer durchsetzbar. Doch Island beweist eindrucksvoll, dass weniger Arbeitsstunden der Schlüssel zu mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz und einer besseren Balance zwischen Beruf und Privatleben sein können.
Die Forderung nach kürzeren Arbeitswochen ging zunächst von Gewerkschaften aus, die darauf hinwiesen, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit ohne Lohnkürzung die Lebensqualität der Arbeitnehmer maßgeblich erhöhen könnte. Pilotprojekte, die in verschiedenen Branchen durchgeführt wurden, zeigten schnell positive Ergebnisse. Die Produktivität blieb stabil oder verbesserte sich sogar, und der Stresspegel der Beschäftigten sank deutlich. Besonders beeindruckend ist, dass diese Veränderung nicht nur einigen wenigen zugutekommt, sondern inzwischen einen Großteil der isländischen Arbeitsbevölkerung betrifft. Ein wichtiger Aspekt dieses Modells ist die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter.
Früher arbeiteten viele isländische Frauen aus familiären Gründen Teilzeit, was oft mit schlechteren Arbeitsbedingungen und geringerem Einkommen verbunden war. Durch die Verkürzung der regulären Vollzeitarbeitszeit auf 36 Stunden wurde es möglich, dass viele Frauen eine auskömmliche Vollzeitstelle mit besseren Sozialleistungen akzeptieren können, ohne ihre familiären Verpflichtungen vernachlässigen zu müssen. Gleichzeitig ermöglicht die Flexibilisierung der Arbeitszeit auch Vätern, sich stärker in den Alltag ihrer Kinder einzubringen. Das traditionelle Rollenbild, nach dem die Männer lange Stunden im Büro verbringen und die Frauen sich um Haushalt und Familie kümmern, wird so weiter aufgebrochen und langfristig verändert. Ein konkretes Beispiel aus dem Alltag zeigt, wie diese neue Struktur das Privatleben verbessert.
Ein isländischer Regierungsbeamter entschied sich, an zwei Freitagen im Monat komplett frei zu nehmen. Diese freie Zeit nutzt er, um sich auszuruhen, seinen Hobbys nachzugehen und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Seine Frau, eine Lehrerin, kann deshalb an diesen Tagen entspannen und sich regenerieren, was Burnout vorbeugt und die Lebensqualität beider deutlich erhöht. Die Herausforderung, Arbeitsabläufe an die verkürzte Woche anzupassen, bestand darin, Gewohnheiten zu überdenken. Manche Betriebe komprimieren Arbeitstage leicht, andere reduzieren Pausen oder reorganisieren Meetings, um Zeit effizienter zu nutzen.
In jedem Fall steht eine verbesserte Priorisierung und Fokussierung der Arbeit im Vordergrund. Trotz dieser Anpassungen berichten viele Arbeitgeber und Beschäftigte von einem spürbaren Gewinn an Lebensqualität, ohne dass dabei die Qualität der Arbeit oder die Produktivität leidet. Das positive Fazit der isländischen Arbeitszeitreform wirkt weit über die Landesgrenzen hinaus. Länder wie Deutschland, Portugal, Spanien und Großbritannien beobachten die Entwicklung mit großem Interesse und starten eigene Pilotprogramme, um ebenfalls die Vorteile einer kürzeren Arbeitswoche zu erkunden. Die Situation in Belgien zeigt jedoch, dass es dabei auf das konkrete Modell ankommt.
Dort gilt gesetzlich eine vier Tage Woche, bei der die gleichen Stunden aber in weniger Tagen gearbeitet werden müssen, was weniger attraktiv ist und bisher kaum angenommen wurde. Die isländische Lösung schafft hingegen mehr echte Freizeit, ohne die Anzahl der Stunden zu erhöhen oder zu komprimieren. Neben der individuellen Zufriedenheit bringt die verkürzte Arbeitswoche auch gesellschaftliche Vorteile. In der Hauptstadt Reykjavík zum Beispiel hat sich der Verkehr am Freitagnachmittag aufgrund der kürzeren Arbeitszeit deutlich entspannt, was nicht nur den Pendlern zugutekommt, sondern auch die Umwelt schont. Außerdem stehen Arbeitnehmern in Island nach wie vor flexible Zeiten zur Verfügung, um beispielsweise Arztbesuche oder schulische Termine der Kinder wahrzunehmen, ohne Abzüge bei der Bezahlung.
Dies ist ein weiterer Baustein für eine gesunde Balance von Berufs- und Privatleben. Wichtig ist allerdings anzumerken, dass das Modell nicht für alle Berufsgruppen in gleicher Weise anwendbar ist. Besonders in Berufen mit festen Dienstzeiten oder im Gesundheits- und Sicherheitsbereich gibt es noch Herausforderungen. Dennoch zeigen die bisherigen Ergebnisse, dass solche Arbeitszeitmodelle mit Kreativität und gutem Willen für viele Berufe angepasst werden können. In Island ist die Arbeitszeitverkürzung inzwischen tief im Arbeitsleben verankert und hat die Kultur am Arbeitsplatz nachhaltig verändert.
Es ist eine Erfolgsgeschichte, die Mut macht, auch komplexe gesellschaftliche Probleme durch innovative Arbeitszeitmodelle zu lösen und dabei das Wohlbefinden der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Kombination aus erhöhter Zufriedenheit, besserer Produktivität und stärkeren sozialen Bindungen macht deutlich, dass weniger Stunden im Büro nicht weniger, sondern mehr Lebensqualität bedeuten können. Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen lohnt es sich, den isländischen Weg weiter zu beobachten und von dessen Erkenntnissen zu profitieren.