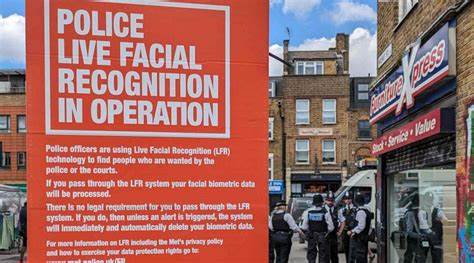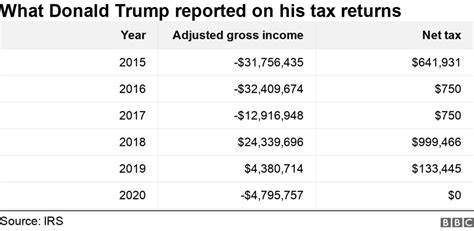Die Materialwissenschaft erlebt einen bemerkenswerten Durchbruch durch die Entdeckung einer völlig neuen Klasse von Kristallen, den sogenannten Interkristallen. Ein Forscherteam der Rutgers University in New Brunswick hat diese besonderen Materialien identifiziert, die das Potenzial besitzen, die Zukunft moderner Technologien nachhaltig zu beeinflussen. Anders als herkömmliche Kristalle weisen Interkristalle elektronische Eigenschaften auf, die auf Grundlage spezieller geometrischer Ausrichtungen entstehen und bisher unbekannte Phänomene ermöglichen. Diese Entdeckung könnte nicht nur die Elektronik revolutionieren, sondern auch den Weg zu effizienteren, nachhaltigeren und vielseitigeren Anwendungen ebnen. Die Entstehung dieser interkristallinen Struktur ist eng mit dem Konzept der sogenannten Twistronik verbunden – eine Disziplin, in der atomar dünne Schichten von Materialien in präzisen Winkeln zueinander verdreht werden, um einzigartige elektronischen Effekte hervorzurufen.
In diesem Fall kombinierten die Forscher zwei ultradünne Schichten aus Graphen, einem nur eine Atomlage dicken Kohlenstoffnetzwerk, mit einer Schicht aus hexagonalem Bornitrid, einem Kristall, der aus Bor- und Stickstoffatomen besteht. Die leicht versetzte Drehung der Graphenschichten auf dem Bornitrid erzeugte sogenannte Moiré-Muster, die das Verhalten der Elektronen in der Struktur drastisch veränderten und bislang unbekannte elektronische Zustände etablierten. Diese neuen elektronischen Zustände ermöglichen es, das Bewegungsverhalten der Elektronen allein durch geometrische Konfigurationen zu steuern, ohne die chemische Zusammensetzung der Materialien verändern zu müssen. Diese Erkenntnis eröffnet völlig neue Möglichkeiten im Materialdesign und stellt eine Abkehr von konventionellen Methoden dar, bei denen elektronische Eigenschaften primär durch das Material selbst und seine chemische Modifikation beeinflusst werden. Die Kontrolle durch Geometrie erlaubt eine höhergradige Feinjustierung und damit das gezielte Erzeugen erwünschter Funktionen auf atomarer Ebene.
Das Potenzial der Interkristalle erstreckt sich über eine Vielzahl von technologischen Bereichen. Beispielsweise könnten in zukünftigen elektronischen Bauteilen Transistoren, Sensoren und andere Komponenten entwickelt werden, die effizienter arbeiten und gleichzeitig weniger Ressourcen verbrauchen. Die erhöhte Kontrolle über die Elektronenbewegung erlaubt es, Bauelemente herzustellen, die sich durch bessere Leistung, geringere Verluste und neue Funktionalitäten hervortun. Auch die Realisierung von Quantencomputern könnte durch interkristalline Materialien wesentlich vorangetrieben werden, da hier die Manipulation von Quantenzuständen zentral ist. Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Materialien ist ihr nachhaltiger und umweltfreundlicher Charakter.
Im Gegensatz zu vielen derzeit verwendeten Hochleistungsmaterialien benötigen Interkristalle keine seltenen oder toxischen Elemente. Sie bestehen hauptsächlich aus häufig vorkommenden, ungiftigen Elementen wie Kohlenstoff, Bor und Stickstoff, was sie zu einer attraktiven Alternative für die großflächige Produktion von Elektronikkomponenten macht. Diese ökologische Vorteilhaftigkeit steht im Gegensatz zu traditionellen Technologien, die oft auf seltene Erden oder andere eingeschränkte Ressourcen angewiesen sind. Interkristalle unterscheiden sich zudem von Quasikristallen, die in den 1980er Jahren entdeckt wurden und bereits die traditionellen Vorstellungen von Kristallstrukturen herausforderten. Während Quasikristalle durch eine geordnete, aber nicht periodische Anordnung der Atome gekennzeichnet sind, zeigen Interkristalle eine Kombination aus nicht-repetitiven Mustern, ähnlich wie bei Quasikristallen, gepaart mit den symmetrischen Eigenschaften regulärer Kristalle.
Dieses Zusammenspiel von Ordnung und geometrischer Spannung führt zu faszinierenden und noch unerforschten physikalischen Eigenschaften. Die Forschungen um Interkristalle sind ein Meilenstein in der Verringerung der Komplexität bei der Entwicklung leistungsfähiger Materialien. Durch das gezielte Anpassen von Winkeln zwischen atomaren Schichten lässt sich das Verhalten von Elektronen spezifisch beeinflussen, was bisher nur mit aufwendigen chemischen Modifizierungen möglich war. Dieser Ansatz eröffnet Herstellern die Möglichkeit, elektronische Bauteile maßgeschneidert und mit hoher Präzision zu entwickeln. Die praktische Umsetzung und die Weiterentwicklung dieses Materials erfordern jedoch noch umfangreiche Forschung.
Es gilt, die Feinstruktur der Interkristalle besser zu verstehen und ihre Stabilität sowie ihre Einsetzbarkeit in verschiedenen Umgebungen zu untersuchen. Auch ihre Integration in bestehende Technologien und Produktionsverfahren ist eine Herausforderung, an der Wissenschaftler und Ingenieure weltweit arbeiten. Eine Besonderheit interkristalliner Materialien liegt in ihren elektronischen Eigenschaften wie Supraleitung und Magnetismus, die in konventionellen Kristallen selten oder nur unter extremen Bedingungen auftreten. Supraleitung ermöglicht den widerstandslosen Fluss elektrischer Ströme und ist ein Schlüsselelement für hochleistungsfähige Elektrotechnik und langlebige elektronische Geräte. Im Kontext von Interkristallen könnten diese Phänomene bei Raumtemperatur oder unter weniger restriktiven Bedingungen beobachtet und genutzt werden, was die Revolution in der Elektronik weiter vorantreibt.