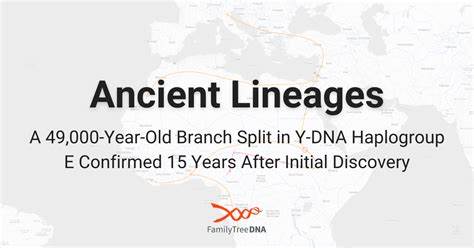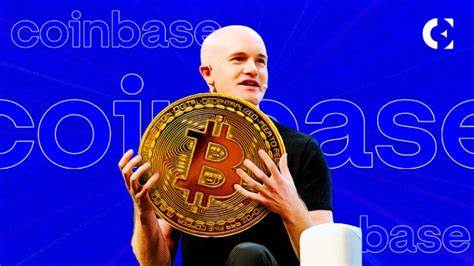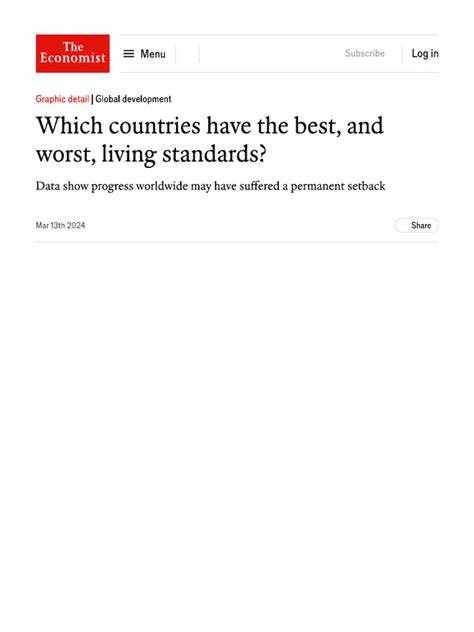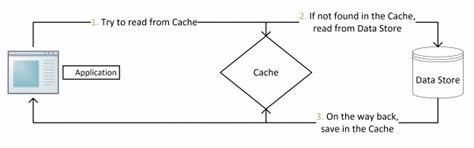Die Sahara, heute als die weltweit größte heiße Wüste bekannt, war in längst vergangenen Zeiten eine grüne und lebensfreundliche Savannenlandschaft. Diese sogenannte Grüne Sahara, die hauptsächlich während der Feuchtperiode des mittleren Holozäns zwischen etwa 14.500 und 5.000 Jahren vor heute existierte, bot Seen, Flüsse und üppige Vegetation, die das Leben verschiedenster Menschengruppen ermöglichte und das Zeitalter der Pastoralwirtschaft in Nordafrika einläutete. Neue Erkenntnisse, basierend auf der Analyse antiker menschlicher DNA aus dieser Region, stellen nun unser Verständnis der Besiedlungs- und Migrationsgeschichte Nordafrikas auf den Kopf und zeigen, dass hier eine weitgehend isolierte, tiefe nordafrikanische Abstammungslinie existierte, die bis heute Auswirkungen auf genetische Profile hat.
Die genetischen Daten stammen von zwei weiblichen Individuen, die vor rund 7.000 Jahren im Takarkori-Felsenschutzgebiet in der heutigen Libyen-Region beerdigt wurden. Diese Personen gehören zur sogenannten Pastoral-Neolithik, einer Epoche, in der Menschen begannen, Tiere zu züchten und Ackerbau zu betreiben, was markante soziale und kulturelle Veränderungen nach sich zog. Ein bemerkenswertes Ergebnis der Genome-Analyse zeigt, dass die Mehrheit ihrer Vorfahren zu einer bisher unbekannten nordafrikanischen genetischen Linie gehört, die schon sehr früh von den Linien der sub-saharanischen Afrikaner, aber auch von allen heute außerhalb Afrikas lebenden Menschen getrennt war. Die genetische Isolierung dieser Linie blieb über einen langen Zeitraum weitgehend erhalten.
Interessanterweise sind diese Takarkori-Individualen eng verwandt mit den für 15.000 Jahre alten Jägern aus der Baumgrotte Taforalt im heutigen Marokko, die mit der Iberomaurusischen Kultur in Verbindung gebracht werden. Diese archäologische und genetische Verbindung zeigt eine Kontinuität und Stabilität der Populationen in Nordwestafrika über mehrere Jahrtausende hinweg. Zudem ergibt sich ein Bild von limitiertem genetischem Austausch zwischen den damaligen Bewohnern Nordafrikas und den Bevölkerungen südlich der Sahara. Dies bedeutet, dass trotz ökologischer Veränderungen und der Ausbreitung der Feuchtphasen die Sahara als genetische Barriere wirkte, die den Austausch von Genen zwischen Nord- und Subsahara-Afrika weitgehend verhinderte.
Ein weiteres spannendes Studienergebnis betrifft die Neandertaler-DNA in den Populationen. Während heutige Nicht-Afrikaner in ihren Genomen eine gewisse Menge an Neandertaler-DNA tragen, fand sich bei den Takarkori-Individuen eine zehnmal geringere Menge als bei Levantinischen Bauern, aber gleichzeitig signifikant mehr als bei heutigen sub-saharischen Populationen. Diese Differenz unterstützt die Hypothese, dass die Verbindung zwischen frühen Nordafrikanern und außereuropäischen Populationen komplex ist und zeigt, dass diese nördlichen Populationen teilweise einen eigenständigen genetischen Weg genommen haben und nur wenig später von außerhalb Afrikas beeinflusst wurden. Die genetischen Analysen legen nahe, dass die Ausbreitung von pastoralem Wirtschaften in der Sahara nicht durch bedeutende Migrationen dieser Menschen bedingt war, sondern vielmehr durch kulturellen Austausch oder Diffusion. Das bedeutet, dass die Ideen und Techniken der Viehzucht sich zwischen Populationen verbreiteten, ohne dass große Völkerwanderungen stattfanden.
Diese Sichtweise entspricht archäologischen Befunden, die einen allmählichen Wandel in der Lebensweise zeigen, anstelle einer plötzlichen Bevölkerungsersetzung. Die Untersuchungen am Fundort Takarkori zeigen darüber hinaus, dass die in der Gegend lebenden Menschen eine relativ stabile und mäßig große Population bildeten. Datierungen und Isotopenuntersuchungen lassen darauf schließen, dass die Nachkommen der dortigen Gruppen lokal sesshaft waren, mit einem effektiven Populationsumfang von mehreren Hundert bis Tausend Individuen, was für damalige Verhältnisse einen langfristigen Bestand suggeriert. Die Erforschung der mitochondrialen DNA der Takarkori-Individuen zeigt, dass sie haplogroup N anzugehören scheinen, eine der ältesten mtDNA-Linien außerhalb Subsahara-Afrikas. Das unterstreicht die Einzigartigkeit dieser Population und ihre wichtige Stellung in der frühen Geschichte der Menschheit in Afrika.
Diese Entdeckungen revolutionieren das Verständnis der demographischen Entwicklung Afrikas im Holozän und fordern die bisherige Vorstellung heraus, dass Nordafrika stets stark mit sub-saharischen Gruppen vermischt war. Stattdessen existierte offenbar eine eigenständige nordafrikanische Abstammungslinie, die vergleichbar alt ist wie die frühen menschlichen Populationen außerhalb Afrikas und die sich über Jahrtausende hinweg bewahrte. Es zeigt sich, dass die Sahara trotz ihrer periodischen Feuchtphasen und ökologischen Veränderungen weiterhin eine Barriere für genetische Durchmischungen war. Die Gründe hierfür könnten vielfältig sein, darunter nicht nur klimatische und ökologische Faktoren, sondern auch soziale, kulturelle oder geographische Hemmnisse. Die Grünen Sahara-Episoden lieferten zwar neue Lebensräume und zogen Gruppen aus den angrenzenden Räumen an, die genetischen Spuren weisen jedoch darauf hin, dass spätestens im mittleren Holozän kein signifikanter genetischer Austausch zwischen nördlichen und südlichen Populationen stattfand.
Dieselben genetischen Muster sind auch in heutigen afrikanischen Bevölkerungen zu beobachten, die weiterhin eine starke Differenzierung entlang der Sahara zeigen. Die neuen archäogenetischen Daten aus Takarkori öffnen damit eine neue Tür zum Verständnis der menschlichen Geschichte Nordafrikas und bieten einen außergewöhnlichen Einblick in eine der am wenigsten erforschten Regionen der Menschheitsentwicklung. Durch weitere Forschungen, insbesondere mit höheren Genomabdeckungen und zusätzlichen Fundorten, könnten zukünftige Studien noch detaillierter auf die komplexen Demographien und kulturellen Entwicklungen eingehen. Zusammenfassend zeichnet die Forschung ein Bild von Nordafrika als Heimat einer früh divergenten, isolierten Bevölkerung, die unabhängig von den großen Bevölkerungsbewegungen außerhalb Afrikas und der sub-saharischen Regionen existierte. Die Einführung der Pastoralwirtschaft und anderer kultureller Innovationen erfolgte demnach vor allem durch kulturellen Austausch, nicht durch eine ausgeprägte Migration.
Dies stellt einen Paradigmenwechsel dar und erweitert unser Verständnis der menschlichen Wanderungs- und Besiedlungsgeschichte in einem der bedeutendsten Übergangsgebiete zwischen Afrika und Eurasien. Die Erkenntnisse aus der Grünen Sahara unterstreichen die Bedeutung der genetischen Erforschung antiker Populationen als Ergänzung zur Archäologie. Nur durch eine Kombination vielfältiger wissenschaftlicher Methoden lässt sich die facettenreiche Geschichte der Menschheit in all ihren regionalen Nuancen neu beleuchten und besser verstehen.