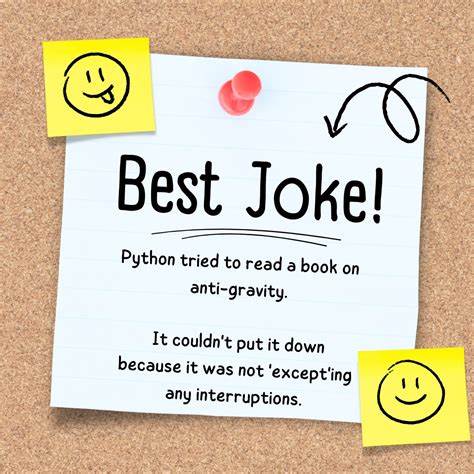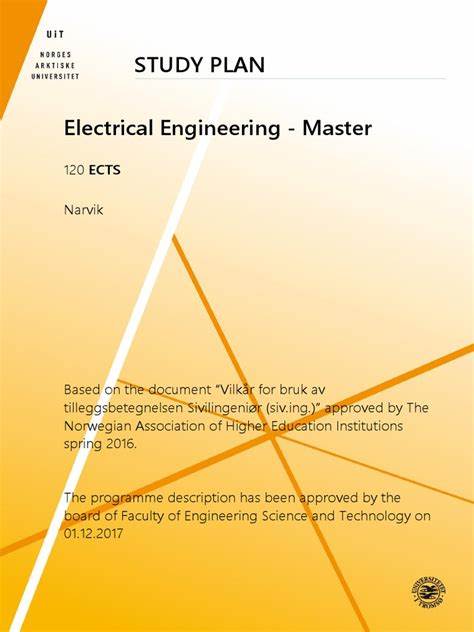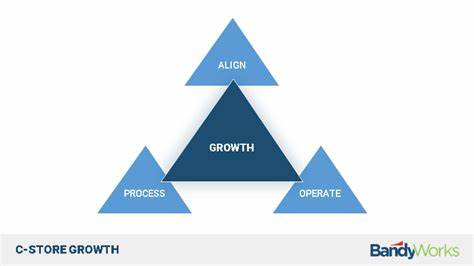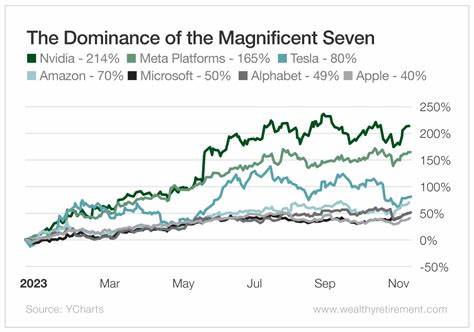Python ist eine der beliebtesten Programmiersprachen der Welt und zeichnet sich durch ihre Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Trotzdem gibt es immer wieder Momente, in denen Entwickler Code schreiben, der kaum schlechter sein könnte – ob absichtlich oder aus Versehen. Schlechter Code kann die Produktivität senken, die Wartung erschweren und bei Teammitgliedern für Frustration sorgen. Aber was passiert, wenn man diesen schlechten Code mit Humor betrachtet? Wenn man versteht, wie man ihn systematisch schreibt, kann man daraus lernen, wie man es besser macht. Das Verfassen des schlechtesten möglichen Python-Codes ist eine Art Kunstform für sich – nicht, weil man tatsächlich schlechter sein möchte, sondern weil man durch das bewusste Schlechtermachen die Fallstricke aufzeigt, in die selbst erfahrene Programmierer tappen können.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Verwendung kryptischer Variablennamen. Namen wie x, y oder z sind jedem bekannt, aber das Problem entsteht, wenn nur kurze, nichtssagende Namen genutzt werden, die keinerlei Hinweise auf die zugrunde liegende Bedeutung geben. Das Resultat: der Code wird zu einem Rätsel, das sich nur mit viel Zeitaufwand und Kopfschmerzen entschlüsseln lässt. Ein solcher Code erzeugt beim Leser sofort Unverständnis. Statt klarer Bedeutung tauchen Begriffe wie data1, data2 oder temp auf – Namen, die keinerlei Kontext bieten und deshalb das Verständnis erschweren.
Wenn Variablen zudem mehrfach in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden, führt das zu Verwirrung und Fehleranfälligkeit. Ausreichend aussagekräftige Namen sind essenziell, um den Lesefluss nicht zu unterbrechen und den Code wartbar zu machen. Neben der Vergabe von schlechten Namen gehört unstrukturierte Programmierung zu den schlechtesten Praktiken. Ein weiterer Klassiker ist das Vermeiden von Kommentaren oder Dokumentation. Obwohl Python sehr gut lesbar ist, helfen Kommentare dabei, komplexere Abläufe, Gründe für bestimmte Entscheidungen oder unerwartete Seiteneffekte zu erläutern.
Das bewusste Weglassen solcher Informationen führt dazu, dass später niemand mehr nachvollziehen kann, warum der Code überhaupt so geschrieben wurde. Zudem begibt man sich in Gefahr, redundanten oder nicht optimierten Code zu schreiben. Schlechter Python-Code zeichnet sich häufig durch unnötige Wiederholungen aus, wie das Kopieren und Einfügen ähnlicher Codeblöcke an verschiedenen Stellen, anstatt Funktionen oder Klassen zu verwenden. Diese Praxis erschwert nicht nur Änderungen, sondern erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, weil beim Kopieren leicht kleine Fehler übersehen werden. Eine konsequente Strukturierung und Modularisierung ist unerlässlich, um Sauberkeit zu gewährleisten.
Ein nicht zu unterschätzender Punkt beim Schlechten-Code-Schreiben ist der Umgang mit Fehlern. Der typische Anti-Pattern besteht darin, Fehler komplett zu ignorieren oder abstrakte Fehlermeldungen auszugeben. Schlechter Code fängt Fehler häufig nicht ab, sodass das Programm unvermittelt abstürzt oder im schlimmsten Fall inkonsistente Zustände entstehen. Es geht sogar noch schlimmer: Wenn Fehler abgefangen, aber ignoriert oder verschleiert werden, erschwert das die Fehlersuche zusätzlich. Im Kontext von Python kann es zudem problematisch sein, gängige Sprachfeatures falsch zu nutzen.
Beispielsweise führt übermäßiges Verschachteln von Schleifen oder Funktionen zu unleserlichem Code, der schwer zu debuggen ist. Auch das bewusste Vermeiden von Pythonic Idiomen, die durch die Sprache vereinfacht werden sollen, sorgt für unnötige Komplexität. Die bewusste Verletzung von Prinzipien wie DRY („Don’t Repeat Yourself“) oder KISS („Keep It Simple, Stupid“) ist ein sicherer Weg, schlechten Code zu produzieren. Humorvoll betrachtet entsteht schlechter Python-Code oft aus einer Mischung aus Zeitdruck, fehlendem Wissen oder mangelndem Qualitätsbewusstsein. Doch genau in diesen Momenten kann man sich fragen: Will man das wirklich? Oder kann man nicht lieber Spaß daran haben, guten Code zu schreiben? Indem man lernt, die häufigsten Fehler zu erkennen und zu vermeiden, bewegt man sich auf dem Weg zum professionellen Softwareentwickler.
Die absichtliche Produktion schlechten Codes kann auch ein pädagogisches Mittel sein. In Workshops oder Schulungen kann man Entwickler herausfordern, absichtlich schlechten Code zu schreiben, um direkt im Anschluss zu erkennen, welche Probleme dieser verursacht. Dieses Vorgehen sensibilisiert für saubere Programmierung und fördert die Reflexion über eigene Arbeitsweisen. Insgesamt zeigt das Schreiben von schlechtem Python-Code auf humorvolle Weise, wie wichtig Sauberkeit, Verständlichkeit und Wartbarkeit sind. Die Identifikation mit solchen Anti-Patterns macht es einfacher, eigene Schwächen zu entdecken und gezielt zu verbessern.